
+++ Leseproben +++
Kontakttagebuch
Donnerstag, 1. Oktober 2020 
Eine Lesung. In einem Kinosaal sitzen statt Menschen Puppen und Stofftiere
auf den Klappstühlen. Die Türen sind weit auf, kühle Herbstluft
strömt in den Nacken. Ich begrüße die Organisatorin der
Lesung mit angedeutetem Ellbogen-Check. Die amputierte Geste ruft ein verlegen-solidarisches
Lächeln hervor: Wir sitzen im selben Boot, und das Boot ist gähnend
leer, so wie dieser Raum. Leere und Kühle und Kontaktarmut und fortwährende
Luftbewegung sind die Gebote der Stunde, und diese Stunde dauert Monate,
ein Ende ist nicht absehbar. Wir Menschen sollen uns so wenig wie möglich
bewegen, von hier nach dort, von Mensch zu Mensch, nur die Luft soll sich
bewegen, zwischen uns, damit die Aerosole sich verteilen, damit Kontakte
weniger gefährlich sind, damit wir weniger gefährlich sind, mit
unserem Atem, mit unserem Dasein, mit unserem Lebenwollen. Die Kühle
und der Argwohn, die das tückische Virus uns auferlegt, machen mich
täglich schaudern. Die Gäste nehmen mit der Gastgeberin auf der
Bühne Platz. Wie angewiesen setze ich mich in die erste Reihe des
Stofftierpublikums und betrete die Bühne erst, wenn ich dran bin,
mit dem Rücken zum Saal stehend, auf die weiße Leinwand starrend,
und in die Gesichter der wenigen blickend, die gekommen sind. Wir haben
so viel Raum, wie wir gar nicht brauchen, doch es tut gut, tatsächliche
Menschen zu sehen. „Physisch“, wie man jetzt präzisiert. All die Videogespräche,
die digitalen Zumutungen, Verwerfungen und Wunderinstrumente stillen den
Kontakthunger nicht.
Gemeldete Infizierte: 25032
7-Tages-Inzidenz: 14,9
An oder mit Corona in den letzten 24 Stunden Gestorbene: 12
Kontakte: die bei mir lebenden halbwüchsigen Söhne, ca. 20
Leute bei der Lesung mit durchgehendem Abstand, ein Freund, der mich im
Auto dorthin und zurück fuhr, Umarmung (mit Luftanhalten) zum Abschied
(...)
Freitag, 13. November 2020
Ich wache auf mit dem neuen Höchststand täglicher Infizierter
von gestern: Das Radio meldet um 6 Uhr die Zahl 21.866. Also weiter keine
Entwarnung. Ich weiß nicht, ob ich froh sein soll, dass der Lockdown
nichts bringt, denn dann hört er vielleicht bald auf, wenn er nichts
bringt, doch ich weiß ja, dass es so nicht funktioniert: Sie müssen
irgendetwas machen. Sie müssen auch Sachen machen, die nichts bringen,
damit sie irgendetwas machen. Sie müssen machen. Sie müssen aktiv
sein. Sie müssen behaupten, dass sie die Kontrolle haben, oder dass
ich persönlich daran schuld bin, wenn der Lockdown nichts bringt,
ich als Metapher für jede Bürgerin, die die Regeln bricht. Ich
breche keine Regeln. Ich breche nur in Tränen aus, aber heute nicht,
bis jetzt noch nicht. Heute buche ich weitere 74
Online-Kurse, Pilates, Yoga, Fitness. Das ist mein Aufbäumen:
Der Lockdown kriegt meinen Körper nicht klein! Außerdem werde
ich sonst depressiv.
Man muss von Tag zu Tag gehen.
Es kommen auch wieder bessere Tage.
Corona wird uns noch eine Weile begleiten.
So redet man dumm daher, als wenn das hilft, als wenn irgendetwas hilft.
Und es hilft tatsächlich. Kochen hilft, obwohl ich es nicht kann.
Lesen hilft. Schreiben verschlimmert das Wissen, nichts zu wissen, aber
das ist auf eine Art besser als nichts. Schreiben ist immer besser als
nichts, auch wenn es weh tut. Gerade wenn es weh tut. Sogar Schmerz ist
besser als nichts. Und das Laub der Bäume ist immer noch bunt, der
November strahlt von freudvoller Melancholie, als drehte er uns allen eine
Nase. Ist mein Lieblingsmonat. Ist ein ehrlicher Monat. Ist mein Mai.
Infizierte: 23.542
Tote: 218
Kontakte: Töchter, Söhne
(...)
Katharina Körting: Kontakttagebuch
116 Seiten, 10,00 €, Januar 2021, ISBN 978-3-947759-64-4
Das Buch portofrei bestellen
Kurfürstensonate
Szene 13 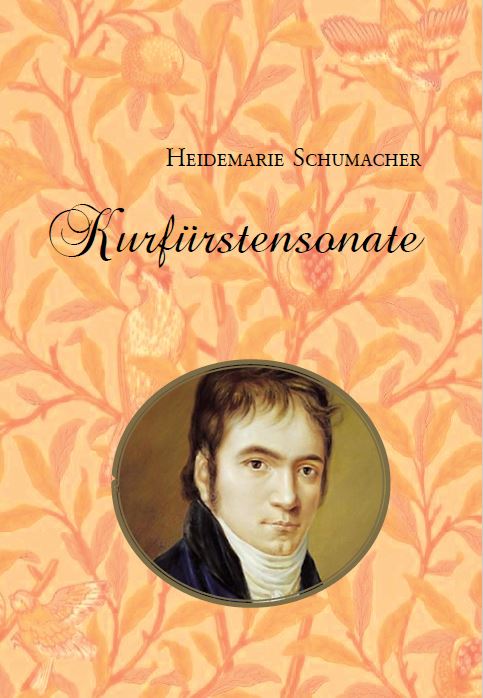
FRAU VON BREUNING / STEPHAN / LEONORE / LUDWIG / HAUSDAME / JEANNETTE
Esstisch bei der Familie von Breuning / daneben seitlich zum Publikum
das Klavier / daneben Teil eines Gartens mit Terrassenstufen. Abendessen.
Am Tisch Frau von Breuning, ihre Kinder Stephan, Leonore und Lorenz, die
Beethoven unterrichtet. Beethoven, eine alte Hausdame und als Gast der
Breunings: Mlle Jeannette D' Hondt aus Köln. Beethoven mit dem Kopf
fast im Teller, schaufelt das Essen in sich hinein, schmatzt.
FRAU VON BREUNING (FVB) Ludwig, so setze er sich doch gerade hin, mein
Lieber. Und führen Sie die fourchette hoch zum Mund, nicht den Mund
zum Teller, so! (macht es ihm vor) Dann wirst du das Essen auch
genießen lernen.
HAUSDAME (für sich) Und für die Mitspeisenden ist
es auch mehr Genuss ...
Stephan und Jeannette flirten, kichern und füßeln miteinander.
Beethoven starrt missmutig zu ihnen hinüber.
FVB Du musst wissen, Ludwig: In unseren Kreisen ist Benehmen zwar nicht
alles, wir heißen ja nicht Schmitz oder Schulz, aber es gilt doch
viel!
Jeannette streicht mit dem Fuß an Stephans Bein entlang.
HAUSDAME (nickend) Ob auf oder unter dem Tisch!
BEETHOVEN (aufgebracht) Ja, viel, das glaub ich wohl! Ich spiele
sechs Stunden am Tag die Orgel, den Rest komponier ich oder bringe Ihren
Kindern das Klavierspiel bei, da bleibt kaum Zeit für Etikette.
FVB Benehmen schadet nie, lieber Ludwig! Du musst vor allem deinen
Raptus in den Griff bekommen, wenn du reussieren willst.
LEONORE Mama, was ist ein Raptus?
HAUSDAME Kinder bei Tisch, stumm wie ein Fisch!
STEPHAN Raptus heißt soviel wie Riss oder auch Raub. Die Mama
meint, dass der Ludwig sich manchmal selbst den Verstand raubt, wenn er
seine Wutausbrüche hat.
LEONORE (begeistert) Ach so! Also wenn der Ludwig seinen Rappel
bekommt, wenn er die Noten vom Pult fegt oder mit der Faust auf die Tasten
schlägt? (Hausdame entsetzt)
STEPHAN So etwa! Aber der geht bei ihm doch auch schnell wieder vorbei,
Maman!
LEONORE (zärtlich) Und dann ist er wieder ganz lieb!
BEETHOVEN (schnäuzt sich laut, düster) Spiele ich
am Ostersonntag in ihrem Salon, gnädige Frau?
JEANNETTE O ja, spiele er doch! Er spielt so passioniert, so habe ich
noch nie jemanden spielen gehört! Raptus heißt auch Entführung,
lieber Ludwig, Entführung und mehr …..
(Sie rückt zu ihm, streicht mit dem Fuß an seinem Bein
entlang; Beethoven sieht ungeschickt unter den Tisch)
BEETHOVEN Ist da die Katz?
HAUSDAME (grämlich) Manche Katz braucht viele Kater!
FVB Wenn du Benehmen zeigst, bist du willkommen. Manchmal sind deine
Ausbrüche schwer zu ertragen. Am Sonntag wirst du hier spielen, meine
Gäste nicht brüskieren, nicht wieder aufspringen und weglaufen,
versprichst du das?
BEETHOVEN (aufgebracht) Bei meinem letzten Vortrag haben die
Herren hinten laut Gespräche geführt. Mein Vortrag wurde gestört.
FvB Versprichst du es Ludwig?
BEETHOVEN Entweder man hört mir zu, oder man geht vor die Tür!
Ich bin besser wie die anderen!
HAUSDAME Besser a l s ...
FVB Versprichst du es Ludwig?
BEETHOVEN Jawohl, gnädige Frau.
FVB Dann hebe ich jetzt die Tafel auf. Lorchen, Lorenz, Ihr geht mit
Ludwig ans Klavier. Um neun Uhr ist Nachtzeit. Ludwig, er bleibt über
Nacht?
BEETHOVEN Wenn Sie erlauben, gnädige Frau!
(geht mit Leonore zum Klavier; Leonore sitzend, Beethoven steht
hinter ihr)
LUDWIG (geduldig) Lorchen, heute wollen wir darauf achten, dass
Du nicht alles bindest. Die Fingerchen heben, heben, heben, der Handrücken
schwebt über den Tasten...
(er beugt sich nah über ihren Nacken und berührt ihn fast
mit seinen Lippen)
LEONORE Ach Ludwig, das Spiel will mir heute nicht gelingen. Spiel
er mir doch etwas vor. Sie haben doch gesagt, Sie hätten eine neue
Komposition, ich möchte sie erlernen.
Ludwig setzt sich hin und spielt (Andante favori WoO 57) Leonore
starrt ihn verliebt an.
LEONORE Wie zauberhaft. Ist das für mich?
LUDWIG (zwinkernd zum Publikum) Nein, für Josephine! Aber
die war leider auch nicht zu haben! Leonore betrübt. Im Hintergrund
geht Frau von Breuning vorbei.
LEONORE Die Frau Mama!
(Frau von Breuning kommt nach vorne, streicht um das Klavier, nah
an Beethoven vorbei und geht wieder hinaus. Ludwig bricht ab).
(...)
Heidemarie Schumacher: Kurfürstensonate
- Theaterstück -
84 Seiten, mit acht historischen Portraits, 9,80 €, April 2020,
ISBN 978-3-947759-46-0
Das Buch portofrei bestellen
Seitenpfade
Vom fröhlichen Lehrer 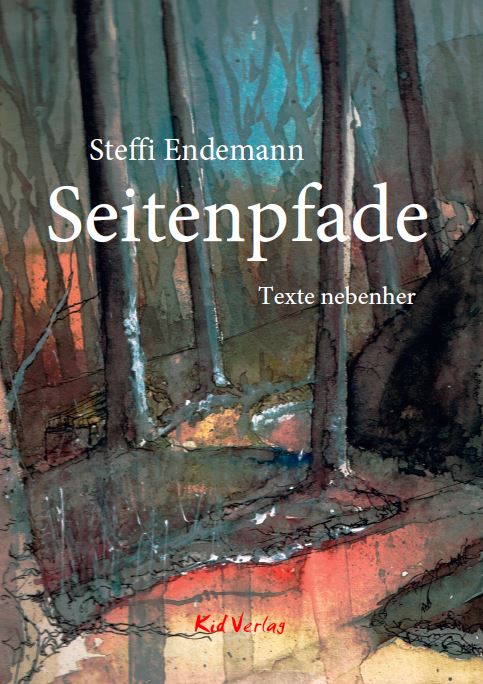
Lehrer M. betrat, wie immer fröhliche Laune verbreitend, das Klassenzimmer
der 10 b. Was Schöneres konnte es kaum geben, als ausgeruht und voller
Tatkraft bei den jungen energischen Knaben anzufangen. O ja, die waren
heute wieder gut drauf, das konnte richtig was werden. Er schritt zum Pult
und sog prüfend die Luft ein, eine Wolke von Jungenssaft und -schweiß.
Ah, wenn ihn nicht alles täuschte, war im Sportunterricht vorher
Geräteturnen drangewesen. Angstschweiß war die typische Basisnote,
ein spezielles Aroma, das ihm verkündete, dass diese Stunde eine gewisse
Dynamik entfalten konnte.
M. hatte die schwere Tasche aufs Pult gehievt und ihr Lehrerkalender,
Stifte und »Lyrik heute« entnommen. Angesetzt und angekündigt:
der »Panther«, Rilke. Da musste man sich kaum vorbereiten,
das geht aus dem Handgelenk, das machte den Nachmittag entspannter.
Anwesenheitsüberprüfung: Einige fehlten, wurden aber von niemandem
vermisst. Vermutlich kiffen gegangen.
„ … so müd geworden, dass er nichts mehr hält.“ M. kannte
das Programm längst in- und auswendig.
Fröhlich blickte M. in die Runde in den mäßig anbrandenden
Lärm, ja, das war vielverheißend: Die meisten bückten sich
schon unters Pult zu ihren Smartphones und tippten weißgottwasimmer.
Das nahm Power raus, zum Glück.
M. war bei weitem nicht so innovationsgeil, wie ein Lehrer heutzutage
sein soll, aber das war keine schlechte Einrichtung. M. blickte wohlgefällig
auf die gebückten Gestalten mit den hängenden Schultern. Das
verhieß Ruhe.
M. hatte bereits zwei Male versucht, seinen fröhlichen Gutenmorgengruß
anzubringen, und hatte inzwischen von einigen eine nicht unfreundliche
Rückmeldung erhalten. Befriedigt registrierte er die konstruktive
Stimmung.
Jetzt ging es lediglich noch darum, einige Jungs auseinanderzubringen,
die sich zwischenzeitlich in eine Schubserei verwickelt hatten und ihm
anklagend den jeweils anderen als Schuldigen präsentierten, M. brachte
mit knapp ausreichendem Erfolg seine Tricks für solche Fälle
an.
Natürlich hatten von den dreißig nur etwa fünf oder
sechs die ausgeteilten Kopien dabei, gar nicht so schlecht, das gab bei
der Übersichtlichkeit des Textes einen Schreibanlass: Bitte abschreiben!
Der erfahrene M. würde natürlich nicht den Text mit Kreide
an die Tafel schreiben und den der Klasse zugewandten Rücken einem
Bombardement entwendeter Kreidestücke und sonstiger Miniobjekte aussetzen.
Rein vorsorglich hatte M. einen Satz vorgedruckter Kärtchen dabei,
die er anschließend wieder einsammeln würde.
Und er schmunzelte bereits in Vorfreude auf die eintretende Stille und
die Mühsal, mit der sich dreißig Fäuste um die Stifte schließen
würden, um die ca. 100 Worte aufs Papier zu bringen. Mit der Hand!
Feinmotorisches Training! Hören, sprechen, lesen, schreiben – eine
gute Übung der Fertigkeiten. Verstehen kommt stets später – oder
auch nicht.
Vergnügt kreiste sein Blick in der Runde, um den gerunzelten Stirnen
abzulesen, welchen Effekt der pädagogische Impuls brächte. Nun
aber sah es leider danach aus, als ob die erste Schwierigkeit des Tages
auftauchen würde, denn, er hätte es sich denken können,
natürlich hatte auch kaum einer Schreibpapier und Stifte dabei. Und
schon begehrten einige auf: Warum sollen wir überhaupt schreiben?
Schreiben Sie doch an die Tafel. So ein Blödsinn! Kein Bock! Und –
die schärfste Waffe: Ist doch laaangweilig! Diese Platte eben. M.
gestattete sich einen kleinen, gut vernehmbaren Seufzer. Diese jungen Leute,
gewohnt, im Minutentakt jeden Schwachsinn unkontrolliert in die Welt abzulassen
und einzufangen, hatten einfach keine Ahnung von den beglückenden
Mühsalen der Schreibkultur.
Krise drohte. Die Stimmung schien ungemütlich zu werden, doch M.
wäre nicht M., hätte er nicht den einen oder anderen Joker. Die
Trickkiste war noch nicht ganz leer, haha.
Erlebnispädagogik war angesagt. Bitte Panther spielen. Textfrei.
Jeder durfte mal. Jeder konnte mal als Panther über den Boden sich
fortbewegen und einem Mitschüler, ach was, Mit-Tier, ins Bein beißen.
Hier verwarnte M. allerdings dringlichst, nur Stoff, nur Stoff.
Plan X gelang, M. brachte sich in Deckung, lauschte dem Gekreisch und
wartete ab, bis sich die übelsten Energien entladen hatten.
Dann kam der letzte Joker ins Spiel. Anschließend über die
Befindlichkeit in der Runde berichten, jeder Egomane hätte seine Chance,
und alsdann Kreatives Schreiben darüber. Jeder Sprachzerfall wird
Ereignis, jede Wortfindungsstörung wird didaktischer Impuls. M. entnahm
mit breitem Lächeln dem Klassenschrank den dort verborgenen Notvorrat
Schreibmaterial.
M. wusste: Diese Stunde würde eine didaktische Sternstunde des
selbstorganisierten Lernens werden, ein erlebnispädagogischer Triumph.
Und wir sind alle eine große, glückliche Familie.
Steffi Endemann: Seitenpfade
- Texte nebenher
132 Seiten, 10,00 €, ISBN 978–3–947759-20-0
Das Buch portofrei bestellen
Rückkehr nach Schapdetten
Wir machen Wellness
Warum kann der Typ nicht einfach die Klappe halten?
Schon in der Sauna hat er ohne Ende auf seine Freundin eingequatscht,
über seine Begegnungen mit Elchen in Finnland und Massagen in Thailand
und so weiter, und jetzt haben sie sich gerade erst hingesetzt zum Abendmenü,
und er setzt seine Monologe nahtlos fort. Er dürfte kurz davor sein,
die 50 zu überschreiten, weißes Hemd und nach hinten gekämmte,
für meinen Geschmack und ehrlich gesagt auch für sein Alter etwas
zu lange Haare, dazu trägt er ein sündhaft teures Sakko. Seine
Begleiterin, die bestimmt 15 Jahre jünger ist als er, sieht, wenn
man genau hinschaut, etwas gelangweilt aus, wobei sie, das muss ich zugeben,
die Situation mit Fassung trägt. Ich wäre längst aufgesprungen
und gegangen.
„Mir fehlt die Ästhetik in Daniel Richters Werk, und der politische
Diskurs ist doch ziemlich einseitig“, doziert er gerade. Seitdem sie Platz
genommen haben, hat er noch nicht einen Augenblick geschwiegen. Jetzt ist
gerade die zeitgenössische Malerei sein Thema, und wenn man ihm zuhört
– und das muss ich leider, weil er sozusagen neben mir sitzt –, dann
kennt er jeden halbwegs bedeutenden Galeristen zwischen New York, Paris,
Köln, Dubai und Shanghai.
Das wichtigtuerische Geschwätz ist kaum auszuhalten, und meine
flache Hand will am liebsten mitten in sein Gesicht schlagen, aber ich
reiße mich zusammen und sage nichts. Dabei macht er hier alles kaputt,
denn bis zu seinem Auftauchen war alles stimmig. Das Beste-Freundinnen-machen-gemeinsam-Wellness-Wochenende,
das Marion und ich uns auch in diesem Jahr einfach mal wieder gönnen
mussten, hat perfekt begonnen. In den wunderschön gestalteten Saunen
und Ruheräumen hier im Taunus-Spa kam die Entspannung ganz von allein,
auch wenn neben der finnischen Sauna gerade ein zusätzlicher Wintergarten
gebaut wird, was hin und wieder zu etwas Lärm führt, auf den
ich gern verzichtet hätte. Aber in der Weitläufigkeit der Anlage
können wir dem entkommen.
Den Rahmen perfekt machen die kleine, aber feine Schwimmhalle und auch
das neue Buch von Sibylle Berg, das mich gleich in seinen Bann gezogen
hat, als ich auf der Liege im Ruheraum – eigentlich ist es eher ein Bett
– die ersten Seiten aufgeschlagen habe. Der Alltag war schon nach einigen
Stunden ganz weit weg. Und weil Mister Labertasche, der Kenner der Elche
und der Malerei, schließlich nur beim letzten Saunagang gemeinsam
mit uns schwitzte, war er gerade noch auszuhalten gewesen. Und jetzt das
Restaurant, das mit seinem uralten runden Steingewölbe noch schöner
aussieht als auf den Fotos im Internet und in unseren Köpfen das Gefühl
römischer Katakomben entstehen lässt. Kerzen leuchten, der Aperitif
zeigt seine erste Wirkung, so dass mein Kopf ganz leicht schwummerig wird.
Das Essen sieht vielversprechend aus und taucht den ganzen Raum in einen
herrlichen Duft.
Gerade wollte Marion von ihrer neuen Bekanntschaft berichten, mal sehen,
ob das was wird, sie ist ja nicht so einfach, was Männer betrifft.
Aber diesmal, sagte sie, diesmal habe sie ein richtig gutes Gefühl.
Der Markus, der ist so lieb, so einfühlsam und gar nicht draufgängerisch,
sondern vorsichtig, auch kein Dummschwätzer, sondern eher zurückhaltend.
Das hat sie zwar von Carlo, Mehdi und – wie hieß der letzte noch,
ach ja: Fabian – anfangs auch erzählt, aber Marion ist euphorischer
als zuletzt. Bei Markus hat es sie wohl richtig erwischt, ihre Augen leuchten,
als sie von ihm erzählte.
Und genau in diesem Augenblick kam dieser Typ rein und wurde an den
Tisch neben uns geführt. Scheiße.
Der Kellner fragt bei ihnen die Getränkewünsche ab, und natürlich
möchte er ein ganz bestimmtes Mineralwasser, aber das Haus führt
die Marke nicht mehr, was zu ernsten Verstimmungen und zu langatmigen Diskussionen
führt, bis schließlich die Wasserbestellung nach fünf Minuten
doch noch geschafft ist. Anschließend entsteht tatsächlich ein
längerer Meinungsaustausch über den vom Haus angepriesenen Prosecco.
Der Meister will seine Expertise vorführen, das soll Claudia, seine
Freundin, er spricht sie in jedem zweiten Satz mit Namen an, wohl beeindrucken.
Demonstrativ ist er skeptisch, bis er sich, gutmütig wie er ist, dann
doch auf die Empfehlung des Hauses einlässt, nicht ohne die Bemerkung
zu seiner Begleiterin, als der Kellner im Begriffe ist zu gehen, dass er
nicht sicher sei, ob der Aperitif seinen Ansprüchen wohl genügen
werde. Sie hingegen hat, ohne lange zu überlegen, einen Aperol-Spritz
bestellt. Claudia wirkt eigentlich ganz normal.
Kaum hat sich der Kellner vom Tisch entfernt, setzt Mister Labertasche
die Berieselung seiner Freundin fort. Es geht um seinen neuen BMW, so viel
bekomme ich mit, ja, muss ich mitbekommen, weil er nicht nur ohne Punkt
und Komma, sondern auch noch sehr laut spricht.
Marion und ich werfen uns einen Blick zu, verdrehen in blinder Übereinstimmung
kurz die Augen und versuchen uns wieder auf unser Gespräch zu konzentrieren.
Sie erzählt weiter von Markus, doch die Leidenschaft, die vorhin noch
aus jedem ihrer Worte sprudelte, ist nicht mehr spürbar. Dann kommt
die Vorspeise, und wir genießen schweigend. Hoffentlich bekommt er
auch bald etwas zu essen, dann dürfte es im Saal deutlich ruhiger
und entspannter werden.
Unser Nachbar hat inzwischen Rotwein bestellt, jetzt darf er probieren.
Allein wie er das Glas hält, macht mich aggressiv. Dann steckt er
seine Kennernase ganz tief hinein, er schnauft und schmatzt, als er den
guten Tropfen im ganzen Mund verteilt, um das Aroma richtig zu spüren.
Der Kellner beobachtet das Schauspiel gelassen und ohne mit der Wimper
zu zucken, denn, davon gehe ich aus, er kennt diese Art von Gästen
nur zu gut.
„Er hallt lange nach und hat fast etwas Erdiges hinter der Frucht, dieser
Trévallon Rouge. Sieh dir nur sein klares Granatrot an, Claudia.
Den nehmen wir zu den frischen Périgord-Trüffeln.“ Der Meister
kennt sich aus, und in den nächsten Minuten prasselt ein Weinvortrag
wie eine Salve auf seine Begleiterin nieder. Claudia tut mir Leid, aber
sie lächelt freundlich und lässt die Belehrungen über Oechsle
und Barrique-Lagerung über sich ergehen. Auch ich fühle mich
nach wenigen Minuten ganz gut über die Reifung des Weines im Eichenfass
informiert und wie man sie geschmacklich von der durch eingerührte
Holzstücke erreichten Note unterscheiden kann. Selbst beim besten
Willen können wir ihn mit einem eigenen Gespräch nicht mehr übertönen.
Wir sind inzwischen beim Dessert, während unser Freund nebenan
bei Geldanlagen und Steuersparmodellen angelangt ist. Es wird immer schlimmer,
meine Stimmung geht gerade so richtig den Bach runter, obwohl das Essen
vorzüglich und der Weißwein, der den Fisch begleitete, auf Idealtemperatur
gekühlt war. Aber was verstehe ich schon davon?
„Morgen werde ich um sieben Uhr in die Sauna gehen“, verkündet
er gerade und Marion flüstert mir zu, jetzt wisse sie wenigstens,
was sie um Sieben ganz bestimmt nicht machen wird. „Das weiß nämlich
keiner, dass da überhaupt schon geöffnet ist. Meine Ex-Frau und
ich haben das immer gemacht, schon allein weil der Sekt zum Frühstück
nach der Sauna erst richtig gut schmeckt.“ Claudia sieht jetzt so aus,
als lege sie keinen gesteigerten Wert darauf, Geschichten von seiner Ex-Frau
zu hören, sondern wirkt eher so, als wolle sie von seinem Gequatsche
endlich erlöst werden.
„Sieben Uhr ist mir zu früh“, sagt sie, als sie endlich mal zu
Wort kommt. „Aber den Sekt zum Frühstück trinke ich mit dir.“
Als wir gehen, lässt er noch mal so richtig den Feinschmecker heraushängen,
erzählt seiner Begleiterin irgendwas von einem Hummer und dass er
als junger Mann nicht richtig wusste, wie man so etwas isst, inzwischen
kann er natürlich nur darüber lachen und macht das auch und zwar
viel zu laut.
Wir begeben uns noch auf einen Absacker in die Bar, wo es angenehm ruhig
ist, bis, und das war ja zu erwarten, auch er nach einer Stunde mit Claudia
reinschneit. Ich merke, wie Wut in mir aufsteigt, und wir brechen umgehend
auf und gehen schlafen.
*****
Morgens um halb sieben schäle ich mich aus dem Bett, mache mir
schnell einen löslichen Kaffee, bevor ich aus dem Zimmer gehe, denn
ich brauche jetzt einen klaren Kopf, dann gehe ich den langen Gang entlang,
wo noch niemand außer mir unterwegs ist, schließlich erreiche
ich den Spa-Bereich und tatsächlich, die Saunen sind wirklich geöffnet,
Mister Labertasche hat also Recht gehabt; ich checke nochmal kurz, wo alles
ist, dann verdrücke ich mich im Ruheraum, bis er kommt, wobei ich
nicht lange warten muss, allerdings erschrecke ich etwas, denn er sieht
ziemlich verquollen aus, vermutlich hat er gestern Abend noch ein paar
Gläser mit seiner jungen Freundin getrunken, doch heute früh
ist er zum Glück allein gekommen, sehr gut, denn ich mache das ja
auch für Claudia, denke ich noch, um sie zu erlösen, alldieweil
er sich, ohne sich umzudrehen, seines Bademantels entledigt und tatsächlich
ohne zu quatschen die Glastür zur finnischen Sauna öffnet und
sich in der hinteren Ecke auf sein Handtuch legt, während ich zur
Eingangstür des Wellnessbereichs zurückgehe, den in der Nacht
am Hotelcomputer heimlich ausgedruckten Zettel aufhänge, auf dem zu
lesen ist, dass die Sauna leider gerade nicht betreten werden dürfe
und dass man für das Verständnis danke, um zehn Uhr gehe es dann
weiter, bevor ich, wie geplant, den gestern noch inspizierten Technikraum
betrete, die Temperatur der Sauna ein gutes Stück nach oben drehe
und die Sicherungen für die Beleuchtung und den Notruf ausschalte,
so dass es fast dunkel ist, als ich von der Wintergarten-Baustelle zwei
Dachlatten packe, die wenigen Meter weitergehe und, wie gestern Abend geübt,
erst die eine und dann die andere Latte zwischen Glastür und Holzgriff
der finnischen Sauna bugsiere und mit einem Ruck unter das Vordach wuchte,
so dass ein Holzkreuz entsteht, das den Eingang und eben auch den Ausgang
versperrt, denn die Tür lässt sich keinen Millimeter mehr öffnen,
und während ich das schnell überprüfe, habe ich das Gefühl,
dass mich aus der Sauna zwei Augen entsetzt anstarren; vielleicht ahnt
er, dass sein Herz- und Kreislaufsystem die zunehmende Hitze nur noch wenige
Minuten aushält, doch ich schaue nicht hin, sondern bereite meinen
Abgang vor und freue mich auf ein ausgiebiges und vor allem ruhiges Frühstück
mit Marion.
Harald Gesterkamp: Rückkehr
nach Schapdetten - Stories
Hardcover, 162 Seiten, 14,80 €, September 2019, ISBN 978-3-947759-31-6
Das Buch portofrei bestellen
Der Yoga-Hype
- Ein Wegweiser für Neugierige und Kritikern
Kommen Sie zurück auf die
Matte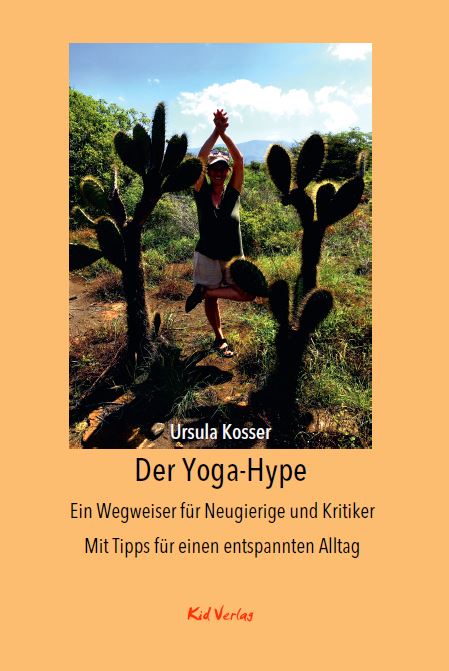
(...) Yoga ist eine Sammlung uralter Weisheiten und ist trotzdem jung
geblieben, ohne je nachhaltig von religiösen oder politischen Eiferern
vereinnahmt zu werden. Versuche dazu hat es immer wieder gegeben. Sie sind
gescheitert, weil Yoga individuell ist, weil Yoga jedem Menschen etwas
anderes zu geben vermag. Sie sind gescheitert, weil Yoga sich über
die Jahrtausende eine Kontinuität bewahrt hat, die nur selten in der
Menschheitsgeschichte anzutreffen ist. Yoga ist ein unbegrenztes Lernfeld
für jeden Einzelnen. Yoga üben kann jeder, der Lust und Interesse
daran hat. Und das ohne Hilfsmittel.
Der neueste Versuch, Yoga für die Massenproduktion in unserer Leistungsgesellschaft
zurechtzustutzen, wird letztlich nicht gelingen. Hoffe ich. Trotzdem sollten
wir die Gefahren, die dem Yoga drohen, nicht übersehen. Und wir sollten
die Möglichkeit eines jeden einzelnen, sich diesem Sog der Vermarktung
zu entziehen, immer wieder thematisieren. Wenn es mir gelungen ist, Sie
mit diesem Text trotz aller Kritik zum Nachdenken oder auch zum Mitmachen
anzuregen, dann wäre das schon was. Dann wären wir dem Ziel im
Yoga, nach dem Gleichklang von Körper, Geist und Seele zu streben,
ein Stück näher gekommen.
Setzen wir uns einfach auf die Matte und bilden für uns und alle
das Zeichen der Ganzheit. Machen Sie aus Zeigefinger und Daumen einen Kreis.
Legen Sie den Daumennagel auf den Nagel des Zeigefingers. Die anderen Finger
sind leicht abgespreizt. Wann immer Sie zum Yoga finden wollen, versuchen
Sie dies und warten, was passiert. Es wird immer anders sein.
Um dies zu erleben, braucht es nicht viel. Ein Baumwollshirt, eine bequeme
Hose, eine Matte und, wenn Sie wollen, ein vibrierendes OM, das mir selber
verkündet: „Ich bin.“
Ursula Kosser: Der
Yoga-Hype - Ein Wegweiser für Neugierige und Kritiker - Mit Tipps
für einen entspannten Alltag
136 Seiten, mit zahlreichen Grafiken und Fotos, Preis: 14,80 €,
August 2019, ISBN 978-3-947759-25-5
Das Buch portofrei bestellen
Ein Gefühl, das
nicht trägt

am horizont
hängt sich das meer an den himmel. ein
frachter versäubert die naht, fällt jählings
durch / die maschen. scheibe oder kugel?
ich dachte, die frage stünde nie wieder auf.
der horizont, in stummer anwesenheit,
drängt / zu nichts. nichts muss gesagt werden.
der wind schleicht herum, schreibt mit
schwarzer tinte / die losung, legt sie ab
zwischen wellen. rasch tänzelt sie auf weißen
spitzen davon. diese wassermassen: ohne netz
und doppelten boden. käme es jetzt darauf an,
mit geschicktem schleuderwurf einen rasch
kleiner werdenden körper zu retten. darüber
ein himmel, der nichts verspricht, der
entscheidet: das maß der zeit gehört euch nicht.
von lichter stirn wischt er den dunklen moment.
aus seinem schatten schälen sich zwei reihen
blau-rot-grüne kisten, quer gestapelt.
auf deck
springt ein scharfer wind / mich an.
wörter kehren sich aus, verständigt auf
ein stilles verweilen. die fähre nahm
den fahrern die fracht aus der hand,
legte die zeit vor sie wie das meer.
zwei haudegen memorieren ihr truckerleben,
wetzen die salzigen lippen, schnippen
die kippen / von bord. ein junger mann
im schneidersitz, mütze, vollbart, shorts,
still / gesenkter blick, verknotet im kopf
ein zitat von seneca: für einen, der nicht
weiß, welchen hafen er ansteuern will,
gibt es keinen günstigen wind. er steht auf,
geht zur reling. wie ein kind / empfangen
die augen die botschaft. das leben strafft sich
und wartet. sichtbar trägt er sein glück
an strammen waden: fünf leuchtend
rote sterne, fett in schwarz gefasst.
Karin Posth: Ein
Gefühl, das nicht trägt
Hardcover, 138 Seiten, 14,80 €, ISBN 978-3-947759-27-9
Das Buch portofrei bestellen
Nach-Klang

(...) „Unterschreibst du hier, Genossin?“
Überall hingen riesige Wandzeitungen mit Parolen und Terminen.
Martha irrlichterte herum, ihr war ganz schwindelig.
Marthas Vorfreude auf ihren poetischen Liebsten ließ das hässlich
möblierte Loch, in dem sie hauste, erträglicher werden und heller.
Sie hatte von einem Freund ein Klavier besorgt, das fast stimmig war, für
80 Mark brachten es zwei breite Kerle in das Loch, alles wurde zur Seite
gerückt, übereinandergestellt, damit Platz wäre für
das Klavier, das für sechs Wochen Friedrichs sein würde.
Er kam, und sie sahen Mickey-Mouse-Filme und aßen Falafel und
spielten Schach im Mifgash, dieser israelischen Kneipe, die fast zehn Jahre
später, im Januar 1982, durch einen Brandanschlag in Flammen aufgehen
sollte. Zu dieser Zeit hatte Martha ihre Gespräche über Marcuse,
über Adorno, die Filme und die Falafeln längst vergessen, erst
als sie Fotos des zerstörten Raumes sah, fiel sie in wehmütige
Erinnerungen an den Geschmack der Falafeln, an die quietschig bunten Filmsequenzen
und einige Gesprächsfetzen. Dass Adorno mit Musik zu tun hatte, hatte
sie damals nicht gewusst, nur, dass er irgendwann in Frankfurt während
seiner Vorlesung nicht über den Tod von Benno Ohnesorg hatte diskutieren
wollen. Eben jenes Studenten, der bei Demonstrationen gegen den Schah-Besuch
am 2. Juni 1967 in Berlin von einem Polizisten erschossen worden war. Martha
wusste nichts über Musikphilosophie oder Musiksoziologie, in der Schule
waren im Fach Musik Volkslieder gesungen worden, und die Mädchen lernten,
Violinschlüssel sauber auf die Notenlineatur zu malen. Insgesamt hatte
Martha sich immer so durchgemogelt, zum Beispiel auch in dem Fach, das
Erdkunde hieß.
„So, Sie sind gegen den Vietnamkrieg? Dann zeigen Sie uns doch mal,
wo das Land liegt.“
Und vorne im Klassenraum hing eine Weltkarte. Vielleicht auch eine von
Asien. So genau guckte Martha gar nicht hin. Keine Ahnung, wo Vietnam überhaupt
lag. War das wichtig?
Sie blieb sitzen, ging nicht zur Karte.
„Stehen Sie auf, wenn ich mit Ihnen rede!“
Sie blieb sitzen.
Ab zum Direktor.
Ihre große Unkenntnis in Geografie aber erstreckte sich auch auf
Näherliegendes. Schwarzwald? Wo sollte das sein? Mit Schwarzwald verband
sie, dass sie als Kind ein Püppchen besessen hatte, auf dessen Strohhut
gewaltige rote Pompons befestigt waren. Das Püppchen hatten Tante
Magga und Onkel Nikolo aus der Kur mitgebracht, in die sie gefahren waren,
weil Tante Magga irgendwie gesunden sollte von einer mysteriösen Krankheit,
so war es hinter vorgehaltener Hand erzählt worden. Schwarzwaldmädel,
so hieß das Püppchen. Und es gab den gleichnamigen Film mit
Sonja Ziemann, einer hübschen Schauspielerin, die Ähnlichkeit
hatte mit Conny, die Froboess hieß, und mit Peter Kraus deutschen
Rock’n’Roll gesungen hatte.
Das war Marthas Ahnung von Geografie.
Der Film „Das Schwarzwaldmädel“, eigentlich eine Operette, war
der erste Farbfilm westdeutscher Produktion nach dem Krieg gewesen, nach
den grauen sogenannten Trümmerfilmen. Mit heiteren Filmen und den
entsprechenden Liedern war Martha aufgewachsen: Mädel aus dem Schwarzen
Wald, die sind nicht leicht zu haben … Tatatata tatata tatatatatatahhta
Seit sie in Berlin studierte, hatte sie geglaubt, sie wüsste
inzwischen beinah alles.
Friedrich ging im Spätherbst 1971 mit ihr in die Universität,
diskutierte in Politik-Seminaren am Otto-Suhr-Institut den Gewaltbegriff,
war klug und eloquent. Martha wunderte sich. Wieso wusste er das alles?
Wieso konnte er so gewandt und ohne Scheu hier öffentlich reden?
Oder sie gingen ins ewig überfüllte Quasimodo, sahen einen
alten schwarzen Mann am Klavier, Champion Jack Dupree, der viel Bier trank,
kalauerte: Two beer or not two beer – that’s the question…und Blues spielte.
Oder sie fuhren in den Osten Berlins, kauften Bücher und Noten, soviel
sie tragen konnten.
In dem Zimmer, in dem die Möbel gestapelt stehen, liegen sie nachmittags
auf Marthas Matratze. Über ihnen das Plakat eines sterbenden Soldaten,
im Fallen verliert er sein Gewehr. Why? Martha kehrt Friedrich den Rücken,
ist erschöpft von der Uni und der Arbeit in einer Fabrik. Er aber
streichelt und schmeichelt so lange, bis sie sich umdreht, in sein strahlendes
Gesicht blickt und ihn umarmt.
In dieser Zeit mit ihm denkt Martha, dass es so etwas wie vollkommenes,
wunschloses Glück gäbe zu zweit.
Martha hatte zu wenig Geld für ihre Entdeckungsreisen in Berlin,
Friedrich hatte gar keins. So nahm er eine Arbeit an für diese sechs
Wochen: allmorgendlich verteilte er Prospekte in einem eisigen, ihm fast
unbekannten Berlin. Sie schrieb unterdessen ihre Referate, ihr war kalt,
sie hatten kein Geld für Kohlen. Er ging morgens die Prospekte holen
und sie verheizten sie. Einmal, als achtlos Prospekte auf dem Kohleofen
lagen, entzündeten sie sich und es brannte im Zimmer. Nach dem ersten
Schreck löschten sie und mussten sehr lachen. Da hätte kein Papier
liegen dürfen. Sie wussten so wenig.
Er hatte Noten aus Ostberlin mitgebracht und spielte auf dem beinah
stimmigen Klavier, bis die Nachbarn sich beschwerten, Arbeiter, die von
der Nachtschicht kamen. Zu Hause, das erfuhr er bald in einem der spärlichen
Telefonate mit daheim, suchten ihn die Feldjäger, irgendwie hätte
er sich, trotz seiner Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer, nicht so
lange entfernen dürfen. Er blieb noch ein paar wehmütige Tage
bei ihr und fuhr dann zurück.
Schon einmal war er als Soldat bestraft worden, als er zum „Zapfenstreich“
um 22.00 Uhr nicht in der Kaserne erschienen war. Er hatte die Nacht mit
Martha verbracht, in ihrem alten Jugendbett in Bonn, ihre Eltern waren
verreist, aber morgens, als Friedrich gegen fünf Uhr das Haus verließ,
hatte sie Angst gehabt, dass ihre ewig neugierige und schlaflose Großmutter,
die im Haus gegenüber wohnte, hinter der Gardine lauern und ihr Geheimnis
verraten könnte. Die Großmutter aber hatte nichts gesehen, jedenfalls
sagte sie nie etwas.
Fünfzig Mark hatte das Zuspätkommen gekostet, wie auf einem
schönen Formular, das Martha nach Friedrichs Tod wiederfand, vermerkt
war: „Disziplinarstrafe“ war das Formular überschrieben. Widerspruch
können Sie einlegen bis zum soundsovielten.
Vor Weihnachten machte Martha an der Freien Universität Berlin
schnell die letzten Referate für ihre Scheine, Politik, Germanistik.
Handels- und Wucherkapital ade! Dieses Wissen würde sie in Bonn nicht
brauchen können. Und Bonn musste es nun wieder sein, da würden
sie nun beide studieren, das war am einfachsten. Da konnte Friedrich den
Zivildienst machen und Martha hatte dort noch viele Freunde, die ihnen
erst einmal Unterschlupf geben könnten. Wo sie wohnen würden,
das fände sich schon.
Geschwind hatte Martha sich noch ein Hausverbot bei Hertie in Neukölln
am Herrmannplatz eingehandelt. Sie hatte versucht, ein Suhrkamp-Buch mitgehen
zu lassen, war aber, weil ungeschickt und aufgeregt, aufgefallen, obwohl
sie einen eigentlich gut geeigneten langen schwarzen Strickmantel trug.
„Wat wolln Se mit dem Buch – äh – Augsburger Kreidekreis?“
„Brauch ich fürs Studium.“
„Warum habn Se‘n dit jestohln?“
„Hab kein Geld.“
„Aha. Dann komm‘ Se ma mit.“
„Lebenslängliches Hausverbot in dieser Filiale unseres Hauses“,
hieß es dann. Damit konnte sie leben.
Martha löste ohne Zögern und ohne Bedauern das finstere Loch
auf, das Klavier holte jemand ab, sie stellte die Möbel in die alte
Ordnung zurück und brachte ihre Habseligkeiten nach Westdeutschland.
Sie besaß:
1 Matratze.
1 Schreibmaschine.
1 Tonbandgerät und Tonbänder.
1 Koffer voll Kleidung.
1 Kiste voll mit Bettzeug und Handtüchern.
1 Kiste voller Schallplatten, Schreibzeug und Bücher.
Der Koffer war aus rotem Kunstleder. Marthas Tante hatte ihn ihr geschenkt,
als sie nach Berlin gezogen war. Die Tante hatte gesagt, das, was sie mit
Berlin verbinde, sei Hildegard Knefs Lied „Ich hab‘ noch einen Koffer in
Berlin“. Martha verstand das Geschenk als solidarische Geste ihr gegenüber.
Gegen ihre Eltern. Und sie freute sich sehr, hatte den Koffer gut gebrauchen
können. Sie hütete ihn lange.(...)
Ellen Klandt: Nach-Klang
- Eine Liebesgeschichte
156 Seiten, Hardcover, 14,80 €, April 2019, ISBN 978–3–947759-21-7
Das Buch portofrei bestellen
Dorfgeschichten

Eine Leseprobe von Michael Wenzel gibt es hier
...
Michael Wenzel: Dorfmenschen
Menschendorf
168 Seiten, mit 12 Zeichnungen von Gerhard
Springer, Hardcover, 14,80 €, März 2019, ISBN 978-3-947759-14-9
Das Buch portofrei bestellen
Der Rhein
aus Bonner Sicht

Eine Leseprobe von Sarah Bertram gibt es hier
...
Sarah Bertram: Zwischen
Hoch- und Niedrigwasser - Der Rhein aus Bonner Sicht
Hardcover, 120 S., mit zahlreichen Fotografien und Grafiken, 16,00
€, März 2019, ISBN 978-3-947759-18-7
Das Buch portofrei bestellen
50 Jahre,
50 Pässe
von Stefan Padberg
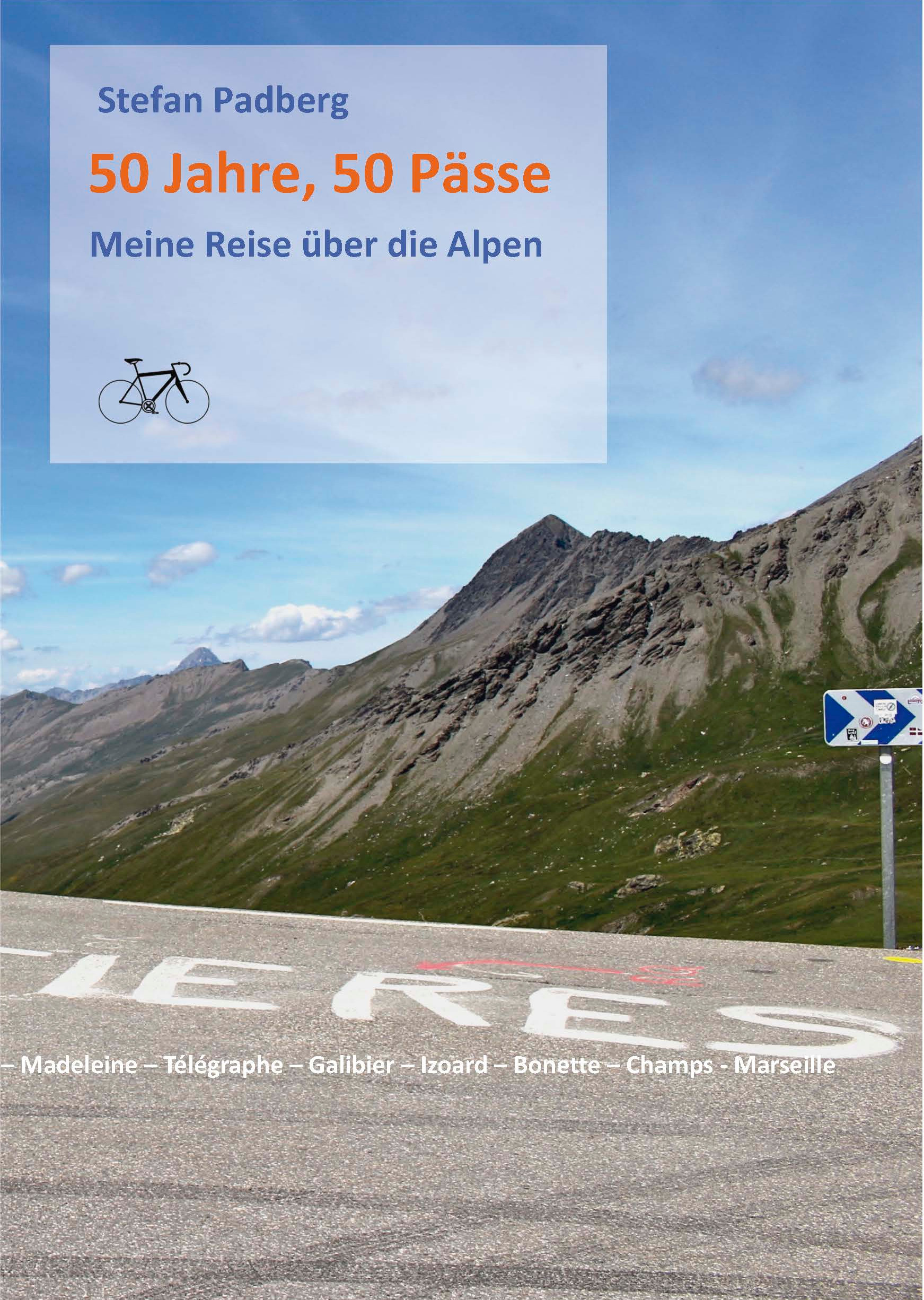
Eine Leseprobe von Stefan Padberg gibt es hier
...
Stefan Padberg: 50 Jahre, 50 Pässe
- Meine Reise über die Alpen
236 Seiten, mit zahlreichen Grafiken und Fotos, 14,80 €, November
2018, ISBN 978-3-947759-05-7
Das Buch portofrei bestellen
Knollenland

(...) Dann ist es soweit. Nun muss es sein, es gibt kein Zurück,
und Hans zieht seine Schuhe an, nimmt den Mantel vom Haken und ist im Begriff,
wortlos den Raum zu verlassen. An der Tür bleibt er stehen, kann die
Mutter nicht ansehen, ergreift die Klinke und zögert. In seinem Kopf
wirbeln tausend Gedanken gleichzeitig herum, für den Moment eines
Wimpernschlags bleibt er dort stehen, dann dreht er den Kopf zur Seite
und spricht in den Raum hinein: „Ich geh nochmal hinunter auf die Straße.“
Seine Stimme krächzt, dann verlässt er den Raum.
Hinter sich hört er die Mutter rufen: „Bleib nicht zu lange, Hans,
wir wollen gleich essen!“
Der Hof liegt in völliger Dunkelheit, geschwind läuft er zum
Schuppen hin, wo er seinen Pompadour ohne Mühe hinter der Kiste findet.
Auf der Straße wendet er sich nach links. Wieder geht er hinüber
zu dem kleinen Bahnhof. Er will dem Verlauf der Geleise folgen. Bis zum
nächsten, vielleicht sogar bis zum übernächsten Dorf will
er die hölzernen Bahnschwellen unter seine Füße nehmen,
und wenn er sich anstrengt, schafft er sogar zwei Hölzer mit einem
Schritt. In dem dortigen Wartehäuschen will er die Nacht verbringen,
auf die erste Bahn am Morgen warten, mit der er bis zur Endstation fahren
will. Dann hat er das alles hier schon ein ordentliches Stück weit
hinter sich gelassen. Aber er will weiter, immer weiter fort von hier,
so lange, bis er findet, wovon er nicht weiß, was es sein wird.
Der Bahnhof Niebich ist bereits geschlossen um diese Zeit. Dunkel und
verlassen liegt das Backsteingebäude mit den verschieferten Giebeln
da. Über dem kleinen Bahnsteig schaukelt die an einem verspannten
Drahtseil hängende Laterne leicht im Wind. Irgendwo quietscht hin
und wieder ein rostiges Metallschild in seiner Verankerung. Vom Dorf schallt
das Bellen eines Hundes herüber. Es ist kalt an diesem Abend, im spärlichen
Licht sieht Hans die Wolken seines Atems. Gegenüber steht immer noch
die endlos lange Reihe offener Güterwagons. Einige sind bis oben hin
mit Zuckerrüben befüllt. Schwer und bedrohlich zeichnen sich
die eisernen Kolosse gegen den dunklen Abendhimmel ab. Entschlossen schreitet
Hans voran. Seine Hände in den Manteltaschen vergraben, springt er
von Bahnschwelle zu Bahnschwelle, bis er stutzt. Ganz in der Nähe
hat er eine Stimme vernommen. Es war die Stimme eines Mannes, und sie klang
zornig. Hans bleibt stehen, zuerst sieht er zum Bahnhofsgebäude hin.
Dort ist niemand zu sehen. Er wartet und will schon weitergehen, als er
die Stimme erneut und jetzt ganz deutlich vernimmt.
„Was willst du?“
Hans versteht jedes Wort, sie dringen von den Güterwagons herüber.
Er zögert, er muss ja weitergehen, doch dann verlässt er das
Gleisbett und lenkt seine Schritte zu den Wagons hinüber. Als er sie
erreicht hat, bückt er sich unter die Puffer und die schwere Verbindungskupplung
hinweg und richtet sich auf der anderen Seite langsam wieder auf. Zuerst
hält er sich zwischen den Wagons verborgen, schiebt jetzt zaghaft
seinen Kopf ein Stück vor, und dann sieht er sie. Hans Helfenstein
erkennt die beiden sofort. Sie stehen am hinteren Ende des Wagons, keine
sechs Meter von ihm entfernt. Deutlich erkennt er das zarte Gesicht von
Renate Ramacher. Sie steht Sepp Preissler gegenüber, auch ihn erkennt
Hans sofort, obwohl er ihn nur von der Seite sieht. Die beiden streiten
miteinander. Sepp schreit und Renate kreischt hysterisch und dann sieht
Hans, was an diesem Abend am Bahnhof Niebich geschieht. (...)
Herbert Pelzer: Knollenland
260 Seiten, Hardcover, 14,80€, Januar 2019, ISBN 978-3-947759-13-2
Das Buch portofrei bestellen
Bring doch Kuchen
mit ...

(...) Als sich dem Bücherregal eine Passantin näherte, hielt
René inne und tat, als ob er hier und dort in dem Buch lesen würde.
Erst dann ging er zum nächsten über. Das kostete Zeit!
In einem Buch fand er einen Einkaufszettel, Salat, Äpfel, Milch,
Mehl, in einem anderen eine Quittung einer Reinigungsfirma, 1 Sakko, 1
Hose. In beiden Fällen hatte sein Herz höher geschlagen, als
die Seiten stockten. Fündig geworden? Nicht fündig!
Inzwischen musste er in die Hocke gehen, weil er am untersten Regalbrett
angekommen war. Beim Blättern drohte er das Gleichgewicht zu verlieren,
balancierte auf seinen Fußballen, einmal kippte er nach hinten, musste
sich mit der Hand auf dem Boden abstützen. Seine Hand tappte auf einen
braunen Lederschuh.
„Suchen Sie versteckte Geldscheine?“, fragte der Mann, zu dem der Schuh
gehörte, und der ihn offenbar beobachtet hatte. René schaute
nach oben, sein Blick glitt an einer gestreiften Krawatte entlang, übersprang
ein Kinn und blieb an zwei großen Nasenlöchern hängen.
„Geldscheine?“, fragte er verwundert die Gestalt hinauf. Ein Banker?
„Ich habe vor einiger Zeit drei Fünfzigmarkscheine in einem zehnbändigen
Lexikon gefunden, das mir eine Tante vermacht hatte. Vermutlich wollte
sie sie glätten und hat sie dann vergessen. Ich musste extra zur Landeszentralbank
fahren, um sie einzutauschen. Einhundertfünfzig Mark!“
René rappelte sich hoch und fühlte sich äußerst
unwohl. Ihm fiel keine passende Erklärung ein; sollte er sagen, dass
er nach einem Foto suchte, oder sogar nach mehreren?
„Nein, ich sammle Lesezeichen“, hörte er sich sagen. Wie originell!
„Lesezeichen?“, fragte der Mann verwundert. René wollte sich
aber nicht weiter über die ungewöhnliche Situation auslassen.
Sollte der Banker doch denken, was er wollte! René zuckte resigniert
mit den Schultern und hoffte, dass der Banker dies als Zeichen seines Unwillens,
das Gespräch fortzusetzen, verstehen würde. Er beugte sich wieder
nach unten, um das Buch zurück in die Lücke zu stellen und registrierte
dabei, dass noch drei Bände übrig geblieben waren, die er noch
nicht kontrolliert hatte. Aber hätte Marie ihr Buch so weit nach unten
in die rechte Ecke des Regals gesteckt? Wahrscheinlich nicht! Allerdings
gefielen ihm die Buchrücken; sie trugen kräftige Farben, und
bei zweien schien die Schrift erhaben zu sein. Ihm fiel ein, dass er noch
weitere Bände benötigte, um sein Regal zu Hause aufzufüllen.
Kurzerhand ergriff er die drei Bücher, richtete sich auf, nickte dem
Banker zu, fühlte sich erleichtert, sowohl die unwürdige Position
als auch Situation beendet zu haben und ließ, fast übermütig,
dem Kopfnicken noch ein „Wiederschauen!“ folgen. Er drehte sich nicht mehr
um, glaubte aber in seinem Rücken die Blicke des Bankers zu spüren.
Zu Hause angekommen, gab René dem Verlangen nach, sich erst einmal
in einen Sessel fallen zu lassen. Eigentlich sollte er für die drei
… hm, Neuerwerbungen einen passenden Platz in seinem Regal finden, eigentlich
sollte er endlich damit beginnen, Maries Buch zu lesen, eigentlich müsste
er sich auch um etwas zu essen kümmern, aber seit dem Vorfall am Bücherregal
eben beschäftigte ihn etwas anderes, über das er schon längst
hätte nachdenken sollen. Marie hatte ihr Foto nicht zufällig
in das Buch gesteckt, wie er ursprünglich angenommen hatte; der Text
auf der Rückseite war auch keine Botschaft an eine bestimmte Person,
einen Freund zum Beispiel. Vielmehr hatte Marie gezielt das Foto präpariert,
es bewusst einem Buch beigefügt und das Buch in das Bücherregal
gestellt. Aber warum? René überlegte. Warum schickten Menschen
eine Flaschenpost, wenn sie nicht gerade auf einer einsamen Insel gestrandet
waren? Warum ließen sie einen mit Gas gefüllten Ballon, mit
einem Zettel versehen, aufsteigen und vom Wind forttragen?
Sie waren neugierig und wollten herausfinden, wie weit die Wasserströmung
ihre Flasche transportierte, oder wie lange sich der Ballon in der Luft
halten konnte. Dementsprechend steckte in der Flasche in der Regel ein
Zettel mit Absendedatum, genauer Adresse und der Bitte an den Finder, Zeit
und Ort der Entdeckung der Flasche an den Absender rückzumelden.
Und was hieß das für Maries Foto im Buch und das Buch im
Bücherregal?
Keine Analogie, stellte der Wissenschaftler René fest. Marie
hatte es dem Finder sogar absichtlich schwer gemacht, sie aufzuspüren:
Adresse: auf dem Foto keine. Nachname: nicht angegeben, auch nicht in der
Anschrift auf der Buchinnenseite. (...)
Günter Detro: Bring
doch Kuchen mit, aber keine Buttercreme
178 Seiten, Hardcover, 14,80 €, erscheint am 15. Dezember 2018,
ISBN 978-3-947759-10-1
Das Buch portofrei bestellen
Die Turbulenzen
des Herrn Rogalla
Der Wörtersammler
„Löwenmäulchen“, rief die Marktfrau, „ein Bund zwei Euro“.
Ich stutzte. „Löwenmäulchen“ hatte sie gesagt, was für ein
Wort. Man stelle sich nur einen Löwen mit einem Mäulchen vor.
Aber das war es nicht allein, was mich aufhorchen ließ. Der Klang
des Wortes schmeichelte meinen Ohren wie ein wohltuender Dur-Akkord. Nur
weiche Laute, ein l, ein w und ein m. Beglückt
zückte ich mein Notizbüchlein und schrieb Löwenmäulchen
unter die lange Liste meiner gesammelten Wörter, die alle eins gemeinsam
hatten: sie enthielten weder ein hartes r, noch ein scharfes s
und schon gar nicht ein abstoßendes sch. Auch p, t
und k waren verbannt. Dafür mochte ich das zurückhaltende
b
und weiche d, das summende s, und geradezu verliebt war ich
in m und l. Kein Wunder, dass ich mir Wörter wie Mimose,
Libelle oder Salami immer wieder auf der Zunge zergehen ließ.
In der Schule bemängelte der Deutschlehrer zwar die fehlende Logik
in meinen Aufsätzen, hob aber stets den Wohlklang meiner Sprache hervor.
Meine Mutter wusste nicht recht, was sie mit so einem Sohn anfangen sollte.
„Das hast du von deinem Vater geerbt“, sagte sie und hoffte inständig,
dass mit Ende der Pubertät sich auch meine „Manie“, wie sie es nannte,
in Luft auflösen würde. Doch da hatte sie sich getäuscht.
Am Ende der Schulzeit schlug mein Deutschlehrer mir vor, es doch mit
dem Studium der Sprachwissenschaft zu versuchen. Ich entschied mich nur
zögernd für das Fach. Sprachwissenschaft, welch abschreckendes
Wort. Eine Ansammlung von Lauten, die dem Ohr weh taten: zweimal sch,
als wolle man jemand verjagen, ein im Rachen gerolltes r, ein gezischtes
s
und am Ende ein herablassendes t. Soviel Missklang konnte nichts
Gutes bedeuten. Ich war überzeugt, dass ein unangenehm klingendes
Wort auch einen unangenehmen Inhalt verkörperte.
Also ging ich mit großem Vorbehalt in das erste Semester. Herr
Dr. Rischler erklärte den wenig interessiert lauschenden Studenten,
dass der Name einer Sache völlig willkürlich von den Menschen
festgelegt werde; die Sache selbst habe nichts mit dem Wortlaut zu tun.
Eine Möwe hätte genauso gut Ratte heißen können oder
eine Hummel Schwein. Das wollte mir nicht einleuchten. Niemand wäre
doch auf die Idee gekommen, eine sanfte Möwe Ratte zu nennen, Ratte
mit krächzendem r und aggressivem t. Das passte nur
zu einem entsprechend abstoßenden Tier. Und eine Hummel, die Schwein
hieß, würde vor Entsetzen nie mehr summen. Ich meldete mich
zu Wort, um meinen Einwand vorzubringen, doch die Kommilitonen lachten
nur belustigt, und Herr Dr. Rischler schmetterte den Einwand mit den Worten
ab, ich argumentiere ganz und gar unwissenschaftlich. Nur das Mädchen
vor mir drehte sich um, sah mich neugierig an und lächelte.
Unerträglich war für mich der Donnerstag, denn da stand Phonetik,
also Lautlehre auf dem Stundenplan. Die Laute der Sprache wurden nicht
etwa nach Wohlklang sortiert, was für mich logisch gewesen wäre,
sondern danach, wie und wo sie im Sprechapparat gebildet wurden. Ich zuckte
jedes Mal zusammen, wenn das Wort Sprechapparat fiel. Warum sagte der Mann
hinter dem Pult nicht Mund? Das klang doch viel angenehmer. Stattdessen
lernte ich, dass p, t, k Okklusive waren, sch dagegen ein
palataler Affrikat. Ich konnte mich einer leichten Schadenfreude nicht
erwehren. Das geschah diesen Lauten recht.
Aber mein geliebtes d sollte ein dentaler Okklusiv und das liebenswerte
l
… , nein, ich wollte es gar nicht erst wissen. So ein dummes Zeug! Deshalb
verließ ich noch am selben Tag die Universität und erklärte
meiner entsetzten Mutter: „Die Sprachwissenschaftler verstehen nichts von
der Sprache. Ich werde mich in Ruhe nach einem anderen Studium umsehen.“
Erst einmal legte ich mir ein Büchlein zu und sammelte Wörter,
die sanft wie eine Welle an mein Ohr gespült wurden: Lavendel, Salamander,
Blumenwiese, Nasenbein. Ich belauschte Menschen im Gespräch und drängte
mich nahe an sie heran, damit mir bloß keine Jagdtrophäe entginge.
Eines Tages saß mir in der Straßenbahn eine junge Mutter gegenüber,
die hingebungsvoll ihr Kind mit Keksen vollstopfte. „Mümmelmännlein“,
sagte sie liebevoll zu ihrem Sohn. Ich fuhr hoch. „Mümmelmännlein“,
das war ein Glücksfund, dreimal m, zweimal l und zweimal
n.
Ich wiederholte das Wort mehrmals genüsslich Silbe für Silbe,
ohne zu merken, dass ich meine Haltestelle verpasste.
Als ich mich schließlich zu Fuß auf den Rückweg machte,
kam ich an dem kleinen Lebensmittelladen vorbei, in dem Monika sich in
ihrer Freizeit Geld verdiente. Monika war die Studentin, die mich bei Dr.
Rischler nicht ausgelacht, sondern mich, wie ich mir immer wieder in Erinnerung
rief, angelächelt hatte. Ich ging deshalb öfter als nötig
in das Geschäft, kaufte Auberginen, die ich nicht zuzubereiten wusste,
Gorgonzola, den ich nicht ausstehen konnte, oder Mehl, von dem ich noch
zwei Kilo zu Hause hatte, nur weil Monika sich gerade in dieser oder jener
Ecke zu schaffen machte. Stets wechselte ich ein paar Worte mit Monalisa,
wie ich sie heimlich nannte, denn so ein besonderes Mädchen konnte
doch unmöglich einen Namen mit einem knackenden k in der Mitte
haben. (...)
Maria
Uleer: Die Turbulenzen
des Herrn Rogalla
176 Seiten, Hardcover, 14,80 €, November 2018, ISBN 978-3-947759-01-9
Das Buch portofrei bestellen
Immer wieder
5. Pilze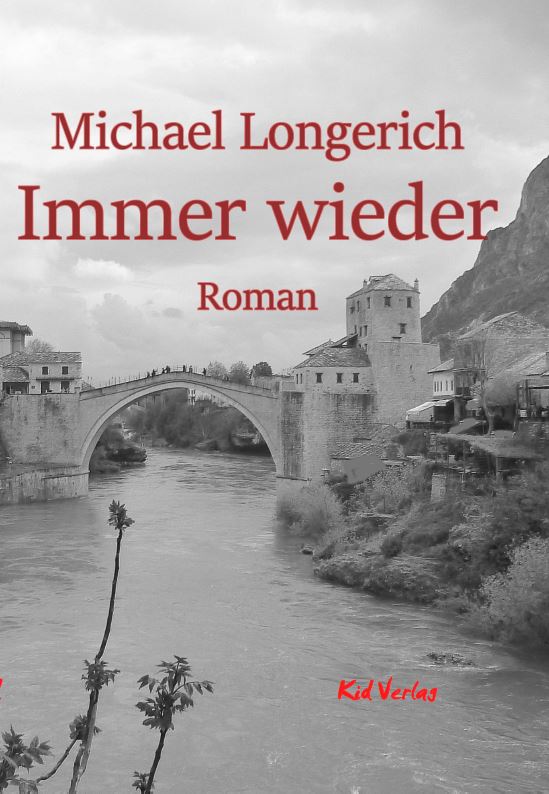
(...) Samira hatte lichte Momente, die stundenlang dauern konnten. Wenn
das der Fall war, konnte sie Gespräche führen und wusste, mit
wem sie gerade sprach. Dann gab es wieder Augenblicke, die sich zu mehreren
Tagen erweitern konnten, wo man nicht sicher sein konnte, dass sie wusste,
wo sie sich befand, mit wem sie sprach und was sie mit dem, was sie sagte,
eigentlich meinte.
„Mein Sohn kommt gleich. Er ist Soldat und verteidigt die Heimat. Mehmet
ist Polizist, er verteidigt auch die Heimat. Sie kommen bald vorbei. Nach
dem Freitagsgebet. Wenn sie da sind, suchen wir alle nach Menja und den
beiden Kindern. Abdulah hilft auch mit. Er muss aber erst noch seine Papiere
in Ordnung bringen. Die sind nicht in Ordnung, haben sie gesagt. Ich kann
ja schon mal losgehen. Abdulah kommt nach, hat er gesagt. Vielleicht zusammen
mit Omer und Mehmet? Ich bereite schon einmal das Abendessen vor. Es gibt
Pilze. Wollt ihr auch Pilze haben? Ich habe sie im Wald gesammelt. Die
sind noch ganz frisch.“
So wechselten Samiras Stimmung und Gefühle von einem Tag auf den
anderen, oft von Stunde zu Stunde. Keiner konnte wissen, welcher Samira
man begegnete: der Samira, die sich erinnern und sich unterhalten konnte,
wenn auch nur mit wenigen Sätzen. Oder der Samira, die eher mit sich
selbst sprach und so stark in der Vergangenheit lebte, dass sie glaubte,
Abdulah oder andere Angehörige ihrer toten Familie könnten jeden
Augenblick erscheinen. In diesen Stunden sprach sie mehr als sonst. Nur
dass der Sinn dessen, was sie sagte, verwirrt war.
Edin, der nicht selten nach der Arbeit den Friedhof besuchte, sah an
einem trüben Herbsttag eine weibliche Gestalt in schwarzer Kleidung
vor dem Grab von Elma sitzen. Es war Samira, völlig in Tränen
aufgelöst. Sie wiegte ihren Oberkörper vor und zurück, klagende
Laute kamen aus ihrem Mund. Edin konnte nicht verstehen, was sie sagte.
Als er sie an der Schulter berührte, fuhr sie zusammen und hob
abwehrend die Hände.
„Samira, ich bin es, Edin“, sagte Edin.
Samira antwortete nicht. Sie trocknete aber immerhin ihre Tränen
ab und schaute abwechselnd auf Edin und den Grabstein.
„Kann ich dir helfen, Samira?“, fragte Edin.
Zögernd kamen die Worte aus Samiras Mund. Unzusammenhängend.
Ab und zu setzte ihr Weinen wieder ein.
„Tot … Sie sind tot … Alle … Abdulah … Das Haus … Goražde … Kinder …
Familie ... Soldaten … Es brennt … Die Brücke … Abdulah … Die Kontrolle
… Wann kommst du, Abdulah? ... Es brennt … Fort, nur fort ... Die Kinder
… Schnell …“
Mit der Zeit beruhigte sich Samira. Edin fand heraus, dass Samira nach
der Pilzsuche manchmal den Friedhof aufsuchte. Abdulah, die Söhne
und Schwiegertöchter, die Enkel – sie hatten keinen Grabstein bekommen.
Sie lagen irgendwo, wahrscheinlich verscharrt. Vielleicht begraben, aber
ohne Namen. Das peinigte Samira, wenn sie die Grabsteine der anderen Toten
sah.
„Deine Frau ist auch tot, wie Abdulah tot für mich ist“, sagte
Samira, die auf einmal wieder zusammenhängend sprechen konnte. „Du
hast ihr einen Grabstein gesetzt. Du kannst hierher kommen und an sie denken.
Wo sind Abdulah, Omer, Mehmet und die anderen? Wo sind sie? Wo kann ich
trauern?“
„Möchtest du nicht hier auf dem Friedhof einen Stein anbringen
lassen?“, schlug Edin vor. „Du kannst vielleicht einen Stein bekommen,
obwohl niemand aus deiner Familie hier begraben liegt.“
Es war möglich. Edin half Samira dabei, die Erlaubnis zu bekommen,
einen Grabstein für ihre Familie errichten zu lassen. Samira kaufte
von ihrem wenigen Geld und mit Unterstützung Edins und anderer Bosnier
ebenfalls einen Grabplatz und ließ dort einen Gedenkstein aufstellen,
der die Namen aller Familienmitglieder trug, die Samira hatte zurücklassen
müssen und die wahrscheinlich tot waren. Ganz oben stand Abdulahs
Name. Dann folgten Omer und Mehmet mit ihren Familien.
Von nun an hatte Samira ein weiteres Ziel für ihre langen Spaziergänge
in der Stadt. (...)
Michael Longerich:
Immer
wieder
277 Seiten, Hardcover, 14,80 €, August
2018, ISBN: 978-3-929386-88-2
Das Buch portofrei bestellen
Die halboffene
Tür
Porträt mit blauer
Blume
Mittelengland, Ende der fünfziger Jahre
(...) Er war kein großer Mann. Graue kurze Haare. Dicke Arbeiterboots.
Er stand. Alle anderen saßen. Im Gerichtssaal war es still, sehr
still. Obwohl er etwas tat, was man nicht tut an einem solchen Ort. Er
stand, zog sein Hemd aus der Hose, ein gewöhnliches, kariertes, begann
es aufzuknöpfen, von unten, verhedderte sich, verlor die Geduld, riss
es hoch und rief: „Seht her, das ist meine Brust. Seht her! Ich bin fünfundfünfzig
Jahre alt. Und das ist meine Brust. Ich bin kräftig. Mein Herz pumpt.
Ich bin kräftig genug, auch diesen als den meinen zu erziehen. Auch
diesen. Mein Fleisch, mein Blut. Er gehört zu uns.“
Er schrie nicht, und trotzdem hallten seine Worte. Dann war es wieder
still im Gerichtssaal. Bis der Richter sagte: „Setzen Sie sich Mr. Adams.“
Er wiederholte es noch einmal in milderem Tonfall, fast zart: „Setzen
Sie sich.“
„Mr. Adams“, nachgeschoben.
„Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück.“
Adams stopfte das Hemd zurück in die Hose. Er drehte sich nach
seiner Frau um, die ein paar Reihen weiter hinten saß. Sie ging nicht
zu ihm.
Mr. Adams wirkte verloren. Das Warten machte ihn irre. Der Blick zur
Tür. Jedes Geräusch ließ ihn aufschrecken. Die Tür.
Wann? Er suchte Halt mit seinen Fingern am Stuhl. Fand keinen. Als sie
hereinkamen, sprang er auf, merkte wie unpassend das wirken musste und
fasste sich wieder. Als er saß, hielt er sich krampfhaft an der Sitzfläche
fest, den Blick gesenkt. Er hörte sich atmen. Einatmen. Ausatmen.
„In der Adoptionssache Geene Adams ist entschieden, das Baby - wie war
noch gleich der Name?“ Der Richter blickte zu seinem Beisitzer, blätterte,
„… Tom, wird den Großeltern, Mr. und Mrs. Adams, zugesprochen.“
Ein Blick zurück in die Reihen, er lächelte. Sie nicht.
Gemeinsam gingen Mr. und Mrs. Adams nach Hause. Er hakte sie bei sich
ein und lächelte. Auch wenn sie drohend blickte. Er kannte ihre Bedingung
und tätschelte ihren Arm. Ein Zugeständnis. Er trug das Lächeln
in seiner Brust durch die Straßen, mit seiner Frau am Arm. Durch
die Straßen von Mittelengland trug er seine Brust. Leicht war sie,
seine Brust. In ihr war alles, was er war und jemals sein würde, seine
Geschichte und seine Zukunft. Das hatte er, George Adams, mit dieser Brust
und diesen Händen geschafft. Sein Fleisch, sein Blut. Sie alle zusammen
unter einem Dach. So würde es sein. Geene, ihre Tochter, und die beiden
Söhne und das Baby. Ein weiteres Kind. Jetzt konnte er sie holen,
aus dem Heim, Geene und das Baby. Nach Hause. Geene und das Baby, das nicht
mehr ihres war, im Hause ihrer Eltern, wo Geene Tochter war, nicht Mutter,
wo es nur eine Mutter gab, das war die Bedingung gewesen, nur eine Mutter.
Unter diesem Dach gab es neben den Eltern nur Kinder, nun eins mehr, sie
alle zusammen, eine Familie.
Tom wuchs heran in dem Glauben, der letzte in einer Reihe von Brüdern
und einer Schwester zu sein. Ein Nachzügler.
Sein in die Welt kommen war bestimmt von dem Verhältnis zu den
Eltern, die nicht seine Eltern waren, zu den Brüdern, die nicht seine
Brüder waren, und zu der Schwester, die nicht seine Schwester war.
Doch für ihn waren sie all das und nichts anderes, seine Familie,
und das war noch nicht mal gelogen. (...)
Viola Michely: Die
halboffene Tür
144 S., Hardcover, 14,80 €, Juni 2018, ISBN 978-3-929386-85-1
Das Buch portofrei bestellen
Kindheitsgärten
Der Kirschenbaron
Die Bahnstrecke zwischen Koblenz und Bonn trennte Mehlem in Oberdorf
und Unterdorf und bildete eine wichtige Demarkationslinie für die
Gruppe von fast ausschließlich Jungen, mit denen das Kind Räuber
und Schanditz spielte. Immer wurde zuerst festgelegt, ob im Unterdorf,
das von der Bahnlinie bis zum Rheinufer reichte, gespielt wurde oder im
Oberdorf, das sich von den Bahnschienen bis zum Rodderberg hinzog.
Manchmal musste das Kind passen und konnte nicht mitspielen, weil Freundin
Gisela dringend vorschlug, draußen mit den Puppen zu spielen. Und
wirklich konnte das an warmen Sommertagen zur Abwechslung richtig sein.
Die beiden Mädchen nahmen eine Wolldecke mit, wenn sie mit ihren Puppenwagen
an den nahegelegenen Bahndamm zogen, wo es windstille Wiesenstücke
gab. Auch Fläschchen für die Puppenkinder hatten sie mit, meist
mit Wasser gefüllt, das ihren eigenen Durst löschte, wenn die
‚Kinder’ gar nicht trinken wollten. Gisela brachte ab und zu Brausepulver
mit, sonst nichts. Man war nicht verwöhnt mit Süßigkeiten.
An den Sandweg am Bahndamm entlang grenzte das riesige Gartenareal des
Barons. Die Kinder wussten nicht, wie er wirklich hieß, nicht einmal
die großen Jungen kannten seinen vollen Namen. Aber alle hatten in
diesem Sommer größte Angst vor ihm, seit er einige der Jungen
fix und fertig gemacht hatte, wie sie mehrmals berichteten, nicht ohne
die anderen Kinder vor dem schrecklichen Mann zu warnen.
Es waren gerade die besonders mutigen Jungen gewesen, die in der Nähe
des freiherrlichen Parkeingangs, wo ein enormer Kirschbaum stand, auf die
Mauer geklettert waren, um sich gehörig mit den süßen knackigen
Herzkirschen von gelblichroter Reife einzudecken. Sie hatten nicht damit
gerechnet, dass der Baron höchstselbst sie dabei erwischen würde,
in der falschen Annahme, er sitze in seinem Schloss über irgendwelchen,
nur den Adligen vorbehaltenen Beschäftigungen. Dass er eigenhändig
gärtnern könnte, war ihnen unvorstellbar gewesen.
Nun hatte der Baron sie in strengem, aber ruhigem Ton deutlich zurechtgewiesen
und aufgefordert, sich umgehend aus dem Baum und von der Mauer zu entfernen
und sich hier gefälligst nicht mehr blicken zu lassen, vor allem aber
in den Mittagsstunden nicht wieder derartig zu lärmen. Da er, anders
als die Väter der Jungen in solchen Fällen, weder geschrien noch
Kraftwörter gebraucht hatte, ihnen auch nicht gedroht hatte, die Missetat
zuhause anzuzeigen, hatten sie seine Ermahnung wohl unterschätzt.
Und weil einen von ihnen der Hafer stach, sodass er sich über den
großen weißen Panamahut des Freiherrn lustig machte, die anderen
einfielen, indem sie die Kirschenklauerei frech verteidigten mit der Begründung,
so hätten sie es in der Schule im Gedicht beim Herrn von Ribbeck gelernt,
und der Unterschied sei ja nur, dass es sich nicht um große Birnen,
sondern bloß um ein paar kleine lumpige Kirschen handele, riss dem
Baron der Geduldsfaden. Plötzlich brüllte er sie nieder mit Donnerstimme
und der Drohung, dem Rektor zu berichten, wie dumm sie zusätzlich
zu ihrer Dreistigkeit seien, offenbar nichts vom Gehalt der alten Ballade
begriffen zu haben.
Die Wirkung ließ sowohl an sofortiger Durchschlagkraft wie an
Nachhaltigkeit nichts zu wünschen: Nie mehr trauten die Jungen sich
hierher. Wurde im Oberdorf Räuber und Schanditz gespielt, war es für
das Kind, wenn es zur ausgelosten Gruppe der Räuber gehörte,
eins der sichersten Verstecke. Umgekehrt brauchte man als Schanditz in
dieser Gegend gar nicht erst nach einem der Jungen zu suchen.
Freundin Gisela, die, wie viele der Mädchen, niemals mit den großen
Jungen spielte, wusste dies alles nicht. Sie hätte sonst sicher nicht
vorgeschlagen, dort die Decke auszubreiten. Einen Augenblick lang blieben
die Kinder vor dem Parktor stehen.
Unmittelbar vor ihnen führte eine mit leuchtender Kapuzinerkresse
eingefasste Allee leicht bergan zum Schloß. Zur Rechten hingegen
breitete der Park sich vollkommen eben aus. Verdunkelt durch den Schatten
mächtiggroßer Bäume, die ihn umgaben, lag ein Teich, den
die Großeltern des Barons hatten anlegen lassen. Aber noch in seinen
artefiziellsten Schöpfungen hat es der Mensch doch immer mit der überbordenden
Kraft der Natur zu tun, die an manchen Stätten immer erneut ihre eigene
Herrschaft wiederherstellt, und sie stellt, wie hier inmitten eines Parks,
ihre Hoheitszeichen auf, ebenso wie sie es auch in der Abgeschiedenheit,
fern jeden Menscheneingriffs, getan hätte, die sich von allen Seiten
her wieder lautlos um sie schließt und alles Menschenwerk nach den
ihr eigenen Bedingungen von neuem überzieht. … Die Iris, die ihre
Schwerter dort am Teich mit königlicher Gelassenheit herabsenkte,
richtete nun hoch über dem im feuchten Grund verwurzelten Wasserdost
und dem Hahnenfuß die violett und gelb gefransten Lilienblüten
ihres den Sumpf beherrschenden Zepters auf. *
Die Kinder ahnten damals noch nicht, wie sehr der Blick in diesen Garten
des Barons ein Blick in die Zeitgebundenheit aller menschlichen Gartenkunst
war. Die beiden Puppenmütter begannen zu spielen, nachdem sie es sich
auf der Decke an dem warmen windgeschützen Gartenrand bequem gemacht
hatten. Sie spielten, die Puppenväter seien im Krieg vermisst, und
nun müssten sie ganz allein für die Kinder sorgen.
Plötzlich schaute der Baron, ein großer hagerer Herr, durch
die schwarzen Stäbe seines Parktores. Ob er ihnen schon länger
zugeschaut und zugehört hatte? Das Kind fragte sich dies, während
es den Herrn höflich, doch zurückhaltend grüßte. Die
schreckhafte Freundin begann sofort, die Decke zusammenzulegen. Da fragte
der Baron die Kinder freundlich, ob er ihnen und den Puppen nicht ein paar
Kirschen schenken dürfte. Das Kind antwortete strahlend: „Oja, bitte!
Sehr gerne, Baron!“ und hielt die beiden zu kleinen Hände auf.
„Hier ist ein ganzes Körbchen für euch, frisch gepflückt!
Die Puppenkinder haben doch gewiss Hunger, nicht wahr, meine Damen?“ Und
damit reichte er dem Kind einen kleinen Henkelkorb mit ausgesucht reifen
makellosen Kirschen über das Tor, wo es zur Mitte hin in einem Bogen
niedriger wurde. Das Kind dankte und knickste, wie es kleine Mädchen
damals noch taten, und erkundigte sich, wo es den geleerten Korb später
hinstellen sollte. Es könnte ihn mit dem Henkel an die große
Klinke des Tors hängen. Der alte Herr nickte den Kindern zu und entfernte
sich die Allee hinauf gemessenen Schritts zurück in seinen Park. Entschlossen
breitete die nicht länger stumme Gisela die Decke wieder aus.
Insgeheim beschloss das Kind, niemandem davon zu erzählen, denn
die großen Jungen hätten ihm doch nicht geglaubt.
Dass das Kind sicher spürte, wann es besser war, von manchen Begebenheiten
nicht zu sprechen, währte seit der Geschichte mit dem Gurkenmann.
Es kannte wohl auch den passenden Spruch und hatte durchaus begriffen,
warum Schweigen Gold und Reden Silber sei, und nun wusste es auch, was
es mit gewissen Vor-Urteilen auf sich haben konnte.
*Freie Übersetzung einer Gartenpassage aus: In
Swanns Weltvon Marcel Proust
Monika Lamers: Kindheitsgärten
88 Seiten, Hardcover, 12,80 €, Mai 2018, ISBN 978-3-929386-87-5
Das Buch portofrei bestellen
Freunde, nicht
diese Töne
herausgegeben von Barbara Ter-Nedden
Falk Andreas Funke:
Freunde, nicht diese Töne
Wien, September 1803
Er kommt von der Vorstadt herein, geht über den Naschmarkt, die gekreuzten
Hände über dem Steiß, leicht gebeugt und den Blick zu Boden
gesenkt – als sei das Problem, über dem er brütet, ein ungebärdiger
Hund, der vor ihm läuft und seine Schritte behindert. Obwohl es gerade
noch Sommer war, ist schon wieder Mantelwetter. Der Herbst träufelt
sich in seine Gedanken; das muss sich doch fassen lassen in Klang, in Musik,
in einem Adagio womöglich. Äpfel. Es gibt wieder Äpfel,
pausbackig lachen sie ihn von der Auslage an, lachende Äpfel, na ja,
aber ist denn nicht alles ein Lachen, ein Höhnen mitunter, jetzt,
da die Tage schon deutlich kürzer werden? Ist denn nicht alles ein
großes Tönen? Der strahlblaue Himmel, ein Dur-Akkord, der wabernde
Nebel, ein Ausklingen in Moll. Wenn’s nur so einfach wäre.
Was ihre Äpfel kosten, fragt er die Frau, die Stimme gefärbt
von rheinischem Sing-Sang der grantigen Art. Was ihre Äpfel kosten!
Laut muss er werden, mal wieder, die Alte hört schlecht oder vielleicht
ist es auch nur ihre Wiener Schnodderichkeit, die ihn, den Fremden, spüren
lässt, dass hier eine Weltstadt ist und er nur von irgendwoher, ein
Provinzler. Schnodderich, ein Wort, das hier keiner kennt, er müsste
es ihnen erklären. Oder er haut ihnen vom Klavier aus ein Paar Triolen
um die Ohren, dass ihnen das Hören und Sehen vergeht. Hören:
schon wieder, so kommt es ihm vor, die Welt hört schlechter und schlechter.
Drei Mal musste er heute schreien, um verstanden zu werden oder dass wenigstens
sein Gegenüber den Blick zu ihm wandte, so wie jetzt diese kittelbeschürzte
Marktfrau. Ach, der Herr will Äpfel kaufen … ?
Den Schlüssel! Er hat den Schlüssel vergessen – in seiner
kompositorischen Zerstreutheit. So muss er gegen die eigene Haustür
klopfen. Zweimal und heftig. Dann dreimal und heftiger. Eine Wutfontäne
schießt in ihm hoch. Die Aufwärterin ist nicht auf dem Posten.
Der Adlatus liegt wohl auf dem Kanapee und träumt von eigener Berühmtheit.
Herr van Beethoven aber steht vor der Tür und es wird ihm nicht aufgetan.
Seine Manteltaschen sind ausgebeult von den Rundungen der Äpfel. Lächerlich
kommt er sich vor: wie ein Kamel mit seitlichen Höckern. Hart klopft
er ein, zwei, drei und endlich ein viertes Mal, dass es kracht. Da geht
ihm ein Lichtlein auf: mitten in einem Tag voller Düsternis der Gedanken.
Welch ein Motiv!
Was für eine Kraft! Ein Apfel purzelt aus seiner Manteltasche und
rollt holpernd über die Gasse. Als er sich bückt, ihn aufzuheben,
purzeln zwei, drei weitere Äpfel hinterher; in ihr kleines Gepolter
mischt sich sein Fluch.
Die Aufwärterin öffnet die Tür, den überquellenden
Mistkübel in der Hand. Erschrocken erblickt sie den Herrn des Hauses,
gebückt auf der Gasse nach Äpfeln grapschend. Er richtet sich
auf vor ihr. Ach, die gnädige Frau geruhen mich einzulassen. Oder
will sie nur den Apfeleimer – ach was, den Abfalleimer – auf die Gassen
tragen? Das Weib schaut ihn an, als spräche er italienisch. Ist es,
weil er Abfalleimer statt Mistkübel gesagt hat – oder hört sie
auch schon schlecht? Kein Mensch in Wien nennt einen Mistkübel Abfalleimer,
außer dem Herrn Beethoven. Ach, was soll’s, sagt er und geht schnurstracks
ins Haus, vorbei an der Aufwärterin, die sich nun ihrerseits bückt,
die gefallenen Äpfel aufzuheben. Die hat der Hausherr nun schon vergessen.
Er muss ans Klavier, nimmt sich nicht mal die Zeit, den Mantel auszuziehen.
Hämmert vier Schläge in die Tastatur. Schindler, schreit er,
wo steckt er denn? Das Kompositionsheft ist nicht an seinem Platz, überhaupt
kein Notenpapier, ein Saustall ist das, in dem man nicht arbeiten kann.
Schindler! Beim Aufstehen vom Klavierstuhl schrammt er so heftig über
den Boden, dass er selber erschrickt. Was seine Wut ein wenig ablenkt.
Er geht in die Nebenkammer, wo er Schindler findet, ausgestreckt auf dem
Kanapee mit offenen Augen einen Staubfaden betrachtend, der von der Zimmerdecke
hängt und sich in leichtem Luftzug hin und her bewegt. Beethoven öffnet
den Mund, um noch einmal Schindler zu sagen, zu rufen, doch er muss innehalten.
Es ist der Nachhall, der ihn jetzt erst einholt vom Musikzimmer nebenan.
Der letzte Akkord, den er gerade in die Tasten gehämmert hat, erfüllt
sein Gehör, dass es ihn seltsam bewegt. Luftgeister aus Silberfäden
im flatterhaften Tanz mit Dämonen aus dunklem Draht. Beethoven hebt
den Zeigefinger und schweigt, um das Schwingen der Geistertöne auszukosten.
Ganz Ohr. Wie fein nuanciert die Flitter- und Flatterwesen kommunizieren.
Schindler, sagt er – und seine Stimme vibriert – Schindler, hörst
du das? (...)
Barbara Ter-Nedden (Hrsg.): Freunde,
nicht diese Töne
108 Seiten, Hardcover, Preis: 12,80, Februar 2018, ISBN 978-3-929386-84-4
Das Buch portofrei bestellen
Rotes Dreieck
Politische Kommunikation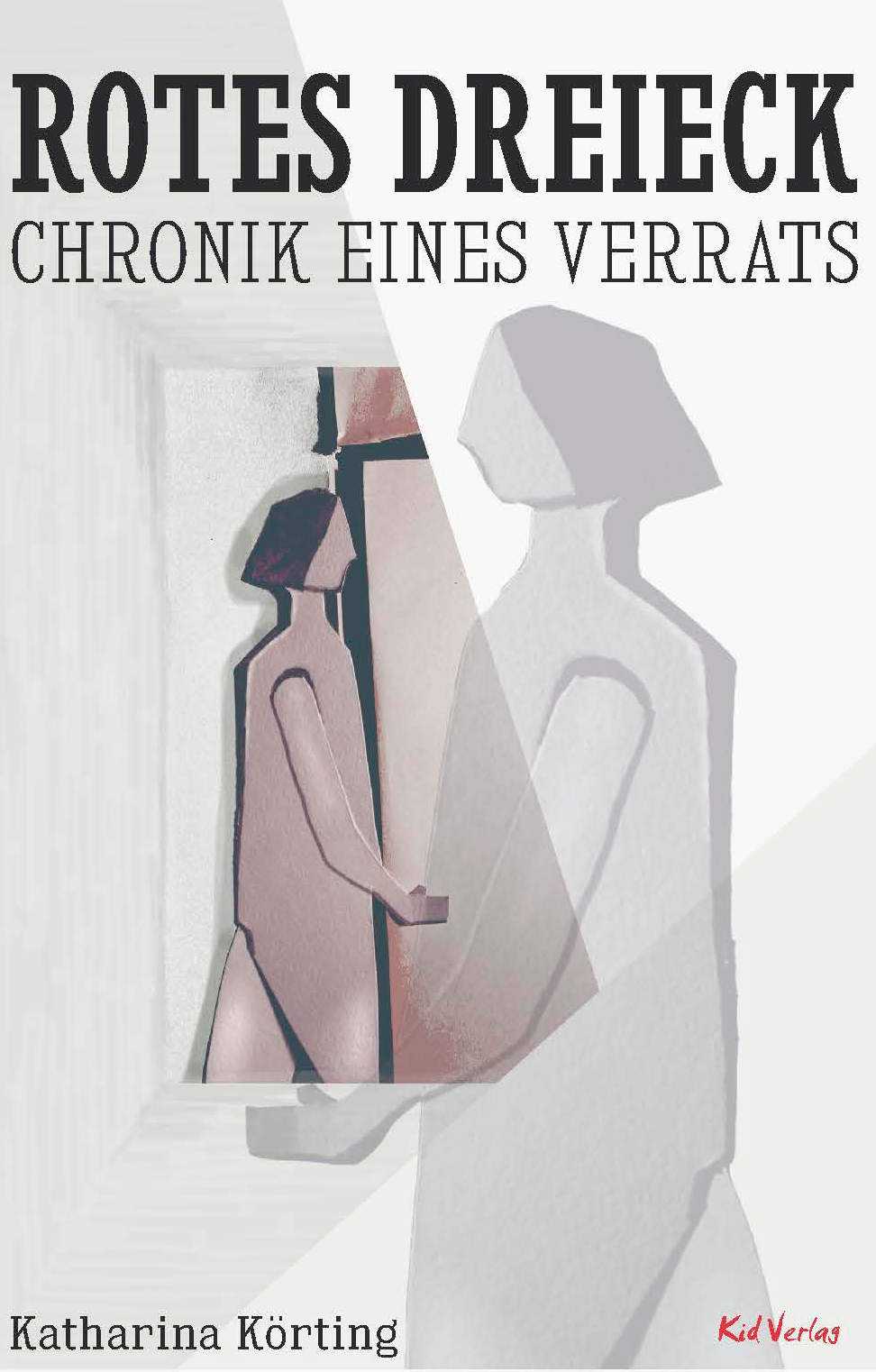
Der Krieg um Aufmerksamkeit tobt hinter den Kulissen der Politik.
Das Geschäftsfeld dieses Krieges heißt „Politische Kommunikation“.
Als Munition fungieren Wörter, Bilder, Informationen und Kontakte.
Öffentlichkeitsarbeit in der Politik hält sich bedeckt. Die Kollateralschäden,
die das Geschäftsfeld „Politische Kommunikation“ am politischen System
und den demokratischen Prozessen anrichtet, bleiben im Dunkeln. Die Soldaten
an dieser Front sind dezent gekleidet. Marlene ist eine von ihnen.
Bevor Marlene für die SFP Wahlkampf macht, muss sie der Geschäftsführer
der Wahlkampfagentur bothshaus, Norbert Both, von ihrer Eignung
überzeugen. Sie hat sich beworben. Both ruft sie an.
(...) „Sie sind halt auch eine von den Überzeugungstätern“,
raunt er, „das gefällt mir. Da sind Sie bei uns gerade richtig! Wir
sind halt auch die Guten! Haha!“„Und Sie sind Berufszyniker“, gibt Marlene
frech zurück.
Für einen Moment verschlägt es ihm die Sprache.
Er räuspert sich. „Hören Sie, Frau Meyrer, das bothshaus ist
nicht irgendeine Werbeagentur. Ich bin marktführend in Kampagnen,
und die SFP hat mich beauftragt! Hinter den Kulissen hat die Schlacht längst
begonnen – da werden halt auch die Stellschrauben gedreht, und Ihre Unterstützung
können wir brauchen.“
„Das ist ja toll.“ Sie versucht, begeistert zu klingen. Werbeagentur
ist das Letzte, was sie wollte. „Zu viel der Ehre“, meint sie mit der gebotenen
Pseudo-Ironie, die sie zu benutzen lernte.
„Wir sind halt auch keine Werbeagentur im eigentlichen Sinne“, versichert
Both, als hätte er ihre Gedanken gelesen. „Ich habe zwar mit Werbung
angefangen, aber ich wollte halt auch mehr, wissen Sie, als ich die Agentur
gegründet habe, und mittlerweile führen wir halt auch in Sachen
Internetmarketing und Online-Campaigning die Branchen-Rankings an. Unsere
Philosophie ist Flexibilität“, sagt er.
Klingt wie ein missglückter Claim. Nein, das sagt Marlene nicht.
„Sind Sie flexibel?“
„Natürlich!“
Sie verschweigt ihre Kinder, verschweigt auch ihre Skepsis gegenüber
diesem dehnbaren Begriff – flexibel.
Sie vereinbaren einen Gesprächstermin, den Both nicht „Vorstellungsgespräch“
nennt. Hierarchien werden in der Branche als „flach“ bezeichnet, weil dann
die Kreativität besser fließt, und die Geschäftsstrategie
heißt „Philosophie“.
Am anderen Tag radelt Marlene zum bothshaus und weiß immer noch
nicht, was sie wert ist. Die Geschäftsräume in Berlin-Mitte sind
präsentabel, inklusive Blick auf die Spree. Was soll sie hier verlangen?
„Was kann ich für Sie tun?“ Eine Frage, die ohne Lächeln
gestellt wird.
Marlene lächelt trotzdem. „Hallo, ich bin Marlene Meyrer und habe
einen Termin mit Ihrem Chef.“
Die Office-Dame zuckt leicht zusammen: Chef sagt man hier nicht. Chef
„ist“ man.
„Kommen Sie mit.“
Sie führt Marlene durch ein Großraumbüro. Ihre künftigen
Kollegen wirken jung, bunt, unbehelligt von der Wirklichkeit, „Hi“, „Na“,
„Was läuft“, gnadenlos locker, grenzenlos optimistisch – menschgewordene
Verkaufsmaschinen von Zuversicht, die all ihre Vorurteile fröhlich
und auf einen Blick zu bestätigen scheinen.
Dann sitzt Marlene auf einem Ledersessel über Eichenparkett dem
Herrn Both gegenüber. Ein kleiner Mann, der jugendlich „rüberkommt“,
obwohl er deutlich älter ist als die Bewerberin: schwarzer Rollkragenpullover
à la Steve Jobs, darüber allerdings noch ein graues Jackett.
Dunkle Brille und um die Lippen eine Andeutung von Bart, die Haare mittelbraun,
die Ohrläppchen angewachsen, das Gesicht rotfleckig, mit einzelnen
weißen Schuppen, die sich gegen sein Make-Up wehren. Seine Stimme
klingt wie am Telefon: näselig, bewandert und doch wie unbeleckt.
Als Verstärkung hat er seinen Abteilungsleiter „Kampagnen“, Fritz
Käfer, dazu gebeten, der während des gesamten Gesprächs
kein Wort sagt.
Marlene spürt ihr Herz klopfen und erwartet, in jedem Moment als
Hochstaplerin hinauskomplimentiert zu werden. (...)
Katharina Körting: Rotes
Dreieck - Chronik eines Verrats
Hardcover, 228 Seiten, Preis: 14,80 €, Februar 2018, ISBN 978-3-929386-79-0
Das Buch portofrei bestellen
Gionos Lächeln
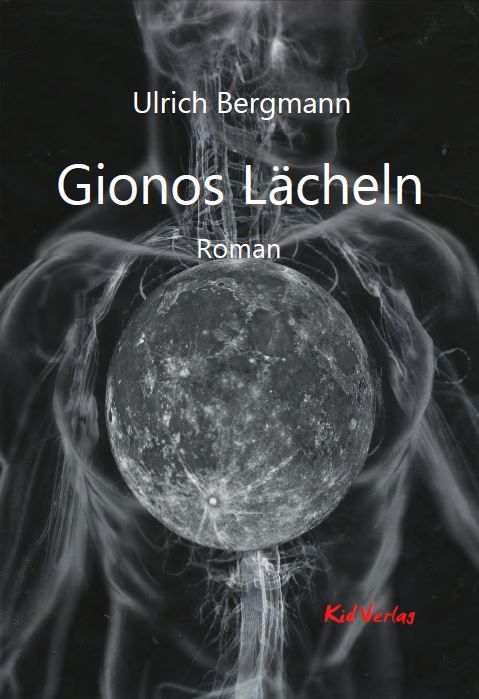
(...) Ich verließ, nachdem ich meinen Koffer ausgepackt hatte,
das Zimmer, stieg auf der dunklen Treppe hinunter ins Helle, legte meinen
Schlüssel auf den Sekretär, durchquerte den Flur und trat durch
die geöffnete blaue Pforte auf die Rue du Dragon.
„Begründe dein eigenes Glück!“, sprach eine Stimme über
mir, ich drehte mich um und schaute hinauf. Das Fenster war halb geöffnet,
das Holz der Fensterläden reflektierte die Stimme aus dem Innern.
„Lebe deine Natur aus gegen den Irrsinn der Gesellschaft!“ Sprach er mit
mir oder mit sich selbst? Vielleicht schrieb er ein neues Manuskript und
sprach den Text des Geschriebenen, um die Satzmelodie zu prüfen. Ich
drehte mich, als ich die kleine Straße hinauf zum Boulevard Saint-Germain
ging, nach ein paar Schritten noch einmal um. Fenêtre à droite,
premier étage. Der linke Fensterladen schlug gegen die Mauer, Giono
lehnte sich aus dem Fenster und sah mir nach. Er lächelte. Ich lächelte
zurück, zog die Hand aus der Tasche und hob sie über die Hüfte
zum Gruß ... Ich lief an der Brasserie Lipp vorbei und schaute hinüber
zu den beiden Cafés, dachte an nichts, bog in die Rue Bonaparte
ein. Bald stand ich am Brunnen von St. Sulpice und schaute ins glitzernde
Wasser – Glas floss über die glatten Steinkanten zwischen den Löwen.
Alles war so durchsichtig, das Leben so leicht, so genau wie die Architektur
des Brunnens, so mächtig und klar wie die Fassade der Kirche mit den
zwei Türmen, vollendet der eine, der andere unbehauen wie die Porta
Nigra. Hinter den Säulen lag die Zeit. Ich ließ den Brunnen
hinter mir und durchquerte den armseligen Eingang im rechten Teil des gewaltigen
Porticus. Ich betrat die Zeit und lief halb blind einige Schritte zur Kirchenmitte.
Hinter mir schlug dumpf die Tür zu.
Ich schaute mich um, stieß gegen einen Körper, stolperte,
eine Hand griff nach mir. „Fallen Sie nicht!“, sagte eine helle Stimme.
Ich blickte in zwei schwarze Augen. Ein Licht aus dem Nichts lief über
mich. Unmessbarer Augenblick und spürbares Parallelenaxiom, war später
mein Gedanke. Ich war aus der Zeit herausgefallen, aber der Ort blieb,
ich erlebte etwas, das ich noch nicht erfahren hatte, ich nahm es vorweg,
ohne es zu ahnen, wusste ohne zu wissen, erkannte und vergaß im selben
Moment. „Komm“, sagte sie. (...)
Ulrich Bergmann: Gionos Lächeln
124 Seiten, Hardcover, November 2017, 16,80 €, ISBN 978-3-929386-76-9
Das Buch portofrei bestellen
Der Kuss
des Delta
Straßenbahnfahrt durch
Bonn

Kaum steig’ ich ein, da merk’ ich schon:
rege Kommunikation.
Die Bahn fährt die bekannte Tour,
doch scheint wichtig, dass nicht nur
wir Fahrgäste dies sicher wissen,
nein, nach draußen muss beflissen
Info raus zum Stand der Dinge,
damit sicher auch gelinge
die Zusammenkunft am Ort.
Und so geht’s in einem fort:
»Bin jetzt schon Museum König,
wart doch bitte noch ein wenig,
paar Minuten, bin ich da,
ja, ganz sicher, ja, ganz klar!
Holst mich ab? – Steig’ hinten aus,
ja, ich komm’ zum Bahnhof raus.
Wart’ mal, muss grad unterbrechen,
ja, wird echt beschissen voll,
hallo, kann jetzt wieder sprechen,
bist noch da? – Krass, ist ja toll.«
Doch erst simultan gelingt,
dass es wie großes Kino klingt:
»Ja, Juridicum jetzt schon« –
»Wie, hörst wirklich keinen Ton?« –
»Nein, nicht du, ich hör dich gut« –
»Hör doch auf, ich krieg die Wut« –
»Nein, das war der andre hier,
kenn ich auch nicht – haste Bier?
Nein? Mann, bist ja echt ’ne Träne!« –
»Wie, was heißt das, andre Pläne?« –
»Nee, das war der Micha grad,
hör doch zu – ach was, ich wart’
an der Rolltreppe ganz hinten.« –
»Nein, nicht ich, ja, musste sprinten.« –
»Gut, dann komm ich auch dahin,
wart’ dann eben, macht ja Sinn.«
Endlich sind wir Hauptbahnhof,
höre noch ein: »Ey, wie doof«,
dann ist’s plötzlich seltsam ruhig,
und ich atme erstmal durch.
Doch dann wird mir ganz schnell klar:
Neue Gäste sind schon da.
Jetzt beginnt’s nochmal von vorn:
»Hab’ den geilen Apfelkorn,
fahr’n grad aus’m Bahnhof raus,
ja, ok, bin gleich zuhaus.«
Will gar nicht wissen, ob das stimmt,
bin froh, dass es ein Ende nimmt.
Herbert Reichelt: Der
Kuss des Delta und weitere Gedichte
Hardcover, 224 Seiten, September 2017, ISBN 978-3-929386-78-3
Das Buch portofrei bestellen
Zwei schöne
Fensterplätze in den Krieg
Der Anfang
Da ist Neid.
Wenn ich als Widmung lese: „Meinem wunderbaren Vater…“
Mein Vater war kein wunderbarer Vater. Er war in vielerlei Hinsicht
nicht einmal ein wunderbarer Mensch – soweit ich das wissen kann. Wie toll
muss es sein, einen wunderbaren Vater zu haben, eine wunderbare Mutter.
Was wäre aus mir und meiner Schwester geworden, wenn wir wunderbare
Eltern gehabt hätten?
Was stelle ich mir unter einem wunderbaren Vater vor? Jemanden, der
mich gehalten hätte, der mich verstanden hätte oder nur: der
bemüht gewesen wäre, mich zu verstehen, meine Motive, meine Wünsche,
meine Ängste. Der mich nicht gegängelt, gestraft, geschlagen
hätte, zum Lügen erzogen. Der nicht immer alles besser gewusst
hätte.
Was stelle ich mir unter einer wunderbaren Mutter vor? Eine Frau, die
mit mir gelacht hätte, nicht über mich, die ihre Liebe zu mir
empfunden hätte, nicht zu mir als ihrem Bild. Die die Stürme
der Pubertät begleitet hätte, statt zu versuchen einzudämmen,
was nicht einzudämmen war, durch kein Verbot.
Das alles und anderes konnten meine Eltern nicht. Sie lebten als junge
Leute im Krieg, waren im Krieg. Das Davongekommensein gab die Kraft, irgendwie
die Träume vom kleinen Glück zu leben, sich daran festzuklammern,
die Kinder da hinein zu zwingen, sie passend zu machen, sie zuzurichten,
in eine Familie, die als unheilige Allianz zweier gegensätzlicher
Charaktere begann. Hier der sportliche, ungestüme, aus Soldatentum
und Kriegsgefangenschaft entlassene Heißsporn, der als Ehemann dennoch
das Leben des Junggesellen endlich haben wollte, da die zielstrebige, sing-
und wanderlustige junge Frau, die mit ihrer ambivalenten Mutterbeziehung
zu kämpfen hatte, ohne dass es ihr bewusst war, und deren höchstes
Glück die Gründung der eigenen Familie verhieß.
Wie ist es dazu gekommen?
Meine Eltern hinterließen hunderte von Briefen, die sie sich in
den Kriegsjahren 1943 bis 1945 geschrieben haben.
Dass es „Feldpostbriefe“ meines Vaters gab, war mir lange bekannt. Meine
Mutter sagte immer, sie habe der Werbung meines Vaters nur deshalb nachgegeben,
weil er so schöne Briefe geschrieben habe. Und das stimmt, wie ich
heute weiß: die Briefe sind schön. Mit schöner Handschrift
geschrieben, voller Verehrung für die ferne Geliebte, voller Liebesverlangen.
Auf meine Bitte, die ich als Jugendliche und auch später, als Erwachsene
äußerte, diese Briefe sehen zu dürfen, ging keiner ein.
Was für eine spannende Geschichte es gewesen wäre! Die Liebesbriefe
des Vaters sehen zu dürfen! Dachte ich. Ein Tor hätte sich öffnen
können in eine weite, unbekannte Welt. Dass es auch Briefe meiner
Mutter gab und ein Kriegstagebuch meines Vaters, wusste ich nicht. So habe
ich diese Papiere bis zum Tode meiner Mutter, die meinen Vater um 19 Jahre
überlebte, nie ansehen können und hatte Sorge, dass sie am Ende
nicht mehr da sein würden.
Nach dem Tod meiner Mutter im Mai 2015 fand sich ein knappes, handgeschriebenes
Testament, kurz nach dem Tod meines Vaters verfasst: Sie hinterlasse „alles“
ihren Töchtern.
Franz‘ Kriegstagebuch, Briefe, Karten und Fotos lagerten in Kartons
auf dem Boden des Kleiderschrankes hinter lange nicht mehr genutzten Dingen,
wie vergessen.
Sie wusste, wir würden diesen Schatz finden nach ihrem Tod. Sie
hatte ihr ganzes Leben Zeit gehabt, diesen Schatz zu vernichten, wenn sie
es denn gewollt hätte.
Die Briefe waren für mich die wichtigste Hinterlassenschaft, erhoffte
ich mir doch Aufschluss über die Haltung meines Vaters zum Nationalsozialismus.
Dass meine Mutter keine Anhängerin des Regimes war, wusste ich. Sie
war nicht in den Bund deutscher Mädel, BdM, die Jugendorganisation
der nationalsozialistischen Partei für Mädchen, eingetreten –
mit dem Argument, sie müsse ihren Eltern im Geschäft helfen –
und sprach stets voll Verachtung über die Propaganda, die dort verbreitet
wurde. Sie sprach voll Verachtung von Hitler und seinem Geschrei.
Mein Vater war ab 1942 vor St. Petersburg, damals Leningrad, stationiert
gewesen. Er hat über diese Zeit nie mit Ernst gesprochen, eher so
obenhin, scherzhaft. Das Kartoffelschälen habe er gelernt, sehr dünn
die Schalen, damit nichts vergeudet würde, er, der so klein war, kein
soldatisches Maß hatte, auch nicht wie ein Arier aussah, eher wie
ein Italiener, klein und schwarzhaarig eben, der Teint dunkel, sei immer
zum Küchendienst kommandiert worden. Oder auf einem Patrouillengang
habe ein Offizier ihm, dem Gefreiten, das Gewehr in die Hand gedrückt:
„Schieß du, ich springe!“ und sei in den Graben gesprungen. Solche
Geschichten. Im Tagebuch und in den Briefen liest sich das anders. Sehr
anders. Das Rauchen habe er sich im Krieg angewöhnt.
Zu meiner großen Überraschung fanden sich nicht nur weit
über 100 Briefe meines Vaters, sondern ebenso viele meiner Mutter
und ein kurzes Kriegstagebuch meines Vaters aus der Zeit vor dem Briefwechsel.
Erstaunlich ist, dass die Briefe meiner Mutter auch existieren, ich nehme
an, dass er sie, ebenso wie sein Kriegstagebuch, auf Heimaturlaub mit nach
Hause nahm oder sie nach Hause schickte. Seine Briefe sind – bis auf die
der allerletzten Kriegstage – vollständig vorhanden, von ihren fehlen
etliche. Sie sind bei einer hastigen Flucht nach einem von den Vorgesetzten
befohlenen Brand, um Akten zu vernichten, in einer Stellung vor Leningrad
versehentlich mit verbrannt.
Ich weiß nicht, warum meine Mutter die Briefe aufgehoben hat –
oder vielleicht weiß ich es doch, weil sie nämlich grundsätzlich
nichts wegwerfen konnte. Irrational ihr Festhalten an einem angeschlagenen
Milchkännchen, in dem sie meinem Vater seinen Kaffee, mit Zucker und
Milch, zuzubereiten pflegte.
Wie kostbar muss meinen Eltern dieser Schatz gewesen sein und wie unfähig
waren sie, ihn mit uns zu teilen. Ich bedauere das sehr, denn viele Fragen,
die sich mit der Lektüre ergeben, müssen so unbeantwortet bleiben.
Ich hatte viele Erwartungen an diese Briefe, die Hoffnung, Antworten zu
bekommen. Das Wichtigste nach der Lektüre: Meine Eltern waren keine
Nazis. Sie waren konservativ, meine Mutter gläubig; sie waren Kinder
ihrer Zeit. Und ich bekomme Antworten auf Fragen, die ich niemals gestellt
habe.
Aber ich verstehe auch: Liebesbriefe sind etwas sehr Intimes. Das möchte
man nicht mit den Kindern teilen.
Als das Kriegstagebuch beginnt, ist mein Vater 20 Jahre alt. Als der
Krieg vorüber ist, 24. Meine Mutter ist während des Briefwechsels
gerade 18 geworden, zu Kriegsende ist sie fast 20; sehr junge Leute, die
sich lange, lange Liebesbriefe schrieben.
Erstaunt hat mich ihrer beider Offenheit, was persönliche Dinge
angeht. Als Eltern habe ich sie verschlossen erlebt; über Persönliches
wurde nicht gesprochen. Erstaunt hat mich ihre gute Rechtschreibung und
ihre Beredtheit, schließlich kamen beide aus kleinen Verhältnissen.
Erstaunt und gefreut hat mich das fröhliche Selbstbewusstsein meiner
Mutter.
Sie haben beide eine schöne, gut leserliche Handschrift, zum Glück
schrieben sie lateinische Schreibschrift, kein Sütterlin. (...)
Ellen Klandt: Zwei
schöne Fensterplätze in den Krieg - Die Geschichte eines Bonner
Paares
175 S., Hardcover, 15,80 €, August 2017, ISBN 978-3-929386-75-2
Das Buch portofrei bestellen
Durch die Jahre
1. Kapitel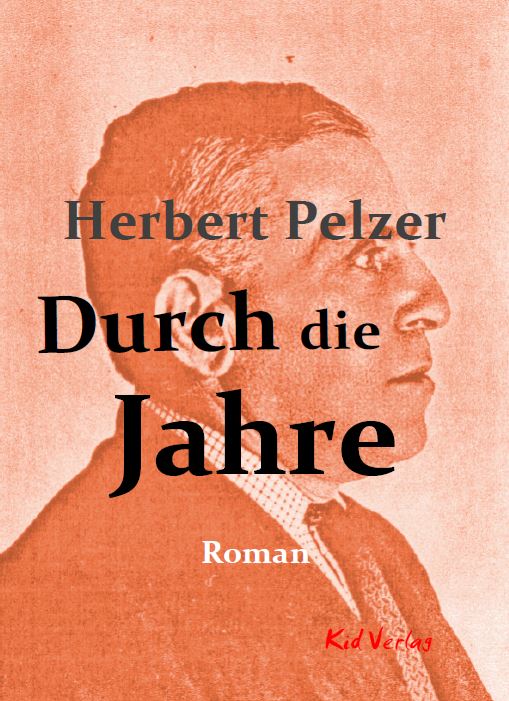
Hinter ihm wurde das schwere eisenbeschlagene Tor geräuschvoll
verschlossen. Er stand auf dem Trottoir, atmete tief die Luft ein, schaute
auf das nasse Pflaster des Adalbertsteinwegs und fühlte sich, obwohl
es kühl war und regnete, so gut wie lange nicht mehr.
»Tschöh, wah«, hatte der Pförtner beim Öffnen
des Tores gesagt. »Ich sach hier nie auf Wiedersehen.«
Und bei jedem Wort hatte sich sein riesiger Schnurrbart bewegt. Josef hatte
nur genickt und war mit raschen Schritten davongegangen. In der linken
Hand hielt er den kleinen alten Koffer, den ihm seine Schwester geliehen
hatte, als er vor einem Jahr in das Gefängnis gebracht wurde, mit
der rechten schlug er den Kragen seiner Jacke hoch und ging nach rechts,
weil er meinte, dass er in dieser Richtung zum Bahnhof gelangen würde.
Rechts neben sich den Bruchsteinsockel des massiven Justizgebäudes,
der ihm fast bis zur Schulter reichte, über sich noch die spitzen
Ecktürme des Turmhauses beschleunigte er seinen Schritt, um möglichst
rasch von hier wegzukommen.
Die Zeit im Gefängnis war furchtbar gewesen, viel schlimmer als
er befürchtet hatte. Oft war er verzweifelt gewesen. Wenn ihm das
Dasein als Häftling unerträglich schien, wenn die Enge und der
Gestank, die Brutalität der Wärter und der Mithäftlinge
ihn zu brechen drohten, wollte er sich manches Mal schon aufgeben. Doch
er war stark geblieben, hatte sich aus allem herausgehalten, alles ertragen.
Durchzuhalten hatte er 1915 in der Champagne gelernt. Dort, im ersten Kriegsjahr,
war es noch schlimmer gewesen. Aber er hatte es geschafft. Da sollten sie
ihn hier doch wohl nicht in die Knie zwingen.
Auf seinem Weg zum Bahnhof sah er sich neugierig nach allen Seiten um,
betrachtete im Vorübergehen die Auslagen in den Schaufenstern, nahm
die Menschen, die Droschken und die Automobile auf den Straßen wahr.
Alles erschien ihm bunt und friedlich, und er verspürte, wie seine
Zuversicht zurückkehrte. Das Leben erschien ihm auf einmal ganz und
gar freundlich, geradezu herrlich leicht.
Mit aufrechtem Gang betrat er die Bahnhofshalle und stellte sich am
nächstbesten Fahrkartenschalter in die Reihe der Wartenden. Der diensttuende
Schalterbeamte saß hinter einer mit Jugendstilornamenten verzierten
Glasscheibe an einem mit dunklem Eichenholz umbauten Tresen und bediente
gelangweilt die Kundschaft. Als Josef an der Reihe war, kaufte er ein Billett
und fragte nach dem nächsten Zug. »Gleis 1, um elf Uhr dreizehn.«
Ohne ihn anzusehen, leierte der Mann die Antwort hinunter, während
er das Kleingeld in die Wechselgeldkasse sortierte, um sich gleich darauf
dem nächsten Kunden zuzuwenden. Josef nahm seinen Koffer auf und schlenderte
durch die Halle. Er hatte noch genügend Zeit und kaufte bei einer
fliegenden Händlerin einen Butterwecken. Oben auf dem Bahnsteig setzte
er sich auf eine Bank, holte den Wecken aus der Papiertüte und biss
hinein. Genüsslich kauend sah er sich um. Hier herrschte ein reges
Treiben, Leute kamen und gingen, manche schienen auf jemanden zu warten,
andere begleiteten ihre Angehörigen, um sie zu verabschieden. Josef
erfreute sich an all diesen Alltäglichkeiten.
Als sein Zug mit quietschenden Bremsen in den Bahnhof fauchte, stand
er auf, ging zur Bahnsteigkante und stellte sich mit den anderen Reisenden
vor der nächsten Waggontüre an. Der Zug war voll. Viele Passagiere
beendeten hier ihre Reise. Umständlich bugsierten sie ihr Gepäck
aus dem Zug, stiegen die steilen Stufen vom Waggon auf den Bahnsteig hinab,
schoben und drängelten und gaben allmählich den Weg für
die Wartenden frei. Vor ihm mühte sich eine hochgewachsene, elegant
gekleidete Frau ihr offensichtlich schweres Gepäck auf die Plattform
zu hieven. »Kein Gepäckträger weit und breit, alles muss
man alleine machen, das wird doch immer schlimmer hier«, zeterte
sie und riss an ihrem schweren Reisegepäck. Josef drängte sich
neben sie, nahm das Gepäck und stieg damit mühelos die Stufen
hinauf. Vor dem nächsten freien Platz im Waggon stellte er es ab,
drehte sich zu der Frau um, lupfte seine Kappe und wollte schon weitergehen,
als sie auf ihn zustürmte und sogleich mit ihrer Schimpftirade fortfuhr:
»Das wäre ja noch schöner, wenn ich mich noch nicht einmal
bei Ihnen bedanken würde, wo man doch tatsächlich noch einmal
einen Kavalier getroffen hat. Es ist eine Schande, wie man als Frau heutzutage
behandelt wird. Junger Mann, bleiben Sie nur hier, ich möchte Ihnen
etwas geben, ich muss nur eben mein Gepäck verstauen, nehmen Sie am
besten hier neben mir Platz. Ich bin gleich soweit. Mein Gott, das ist
aber auch eng hier. Ja, so bleiben Sie doch hier! Hat denn niemand mehr
Zeit heutzutage?« Josef war weitergegangen und hatte am anderen Ende
des Waggons sogar noch einen Fensterplatz gefunden. Rasch hatte er seinen
Koffer in das Gepäcknetz gelegt und war in dem Sitz versunken, froh
darüber, der geschwätzigen Mitreisenden entkommen zu sein.
Im Waggon kehrte allmählich Ruhe ein. Ihm gegenüber saß
ein älterer Herr, der bereits schläfrig wirkte und dem Anschein
nach schon bald in einen leichten Schlaf versinken würde. Josef rückte
seine Sitzposition auf der harten Bank zurecht, fand eine angenehme Haltung
und wartete entspannt darauf, dass der Zug sich in Bewegung setzte. In
Gedanken kehrte er noch einmal zum heutigen Morgen zurück. Wie sehr
hatte er diesen Tag herbeigesehnt, zum letzten Mal hatte er den Weckruf
der Wärter gehört, den widerlich schmeckenden Kaffee trinken
und das altbackene Brot essen müssen. Nun war es vorbei, und er konnte
sich wieder frei bewegen. Er hatte seine Strafe abgesessen. Sie waren quitt,
er und der Staat, er hatte für seinen Fehler bezahlt und wollte das
alles von nun an hinter sich lassen.
Bis es soweit gekommen war, dass er die Wechselbetrügereien begangen
hatte, war es ihm wahrlich gut ergangen. Seine Eltern waren wohlhabende
Leute gewesen. Anerkannt und wohl angesehen lebten sie in dem kleinen Dorf
am Rand der Eifel. Ludwig Treu, sein Vater, hatte eine Metzgerei betrieben
und handelte mit Vieh. Das war für eine lange Zeit ein einträgliches
Geschäft, und es war geplant, dass er, Josef, als einziger Sohn den
Betrieb fortführen sollte. Seine drei jüngeren Schwestern waren
allesamt hübsch, sie besaßen die Anmut der Mutter, sie waren
intelligent, und die Verehrer umschwärmten das Haus, sobald die Mädchen
im heiratsfähigen Alter waren. Vor vier Jahren war dann der Vater
verstorben und ein Jahr später bereits die Mutter. Nun war er das
Familienoberhaupt, musste den elterlichen Betrieb führen und war doch
längst nicht darauf vorbereitet. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt immerhin
schon 32 Jahre alt war, hatte er sich vornehmlich mit den angenehmen Seiten
des Lebens beschäftigt. Zwar hatte er als Soldat im Krieg gekämpft,
doch das hatte ihn nicht verändert. Er war zeitlebens ein Draufgänger
gewesen, und einige seiner Freunde beneideten ihn heimlich, weil er in
ihren Augen ein echter Hansdampf war.
Der Zug hatte sich in der Zwischenzeit in Bewegung gesetzt, hatte die
Stadt verlassen, und in der Ferne tauchten bereits die ersten Ausläufer
der Nordeifel auf. Der alte Mann gegenüber war eingeschlafen, mit
offenem Mund atmete er ruhig und gleichmäßig.
Anfangs hatte es eine Zeit lang so ausgesehen, als ob er das Viehhandelsgeschäft
erfolgreich betreiben könnte. Josef war mit Enthusiasmus an seine
Aufgabe herangegangen und hatte den Bauern vertraut, war immer fair geblieben,
weshalb er sich rasch allgemeiner Beliebtheit erfreute. Die Metzgerei hatte
sein Schwager übernommen, sodass die Geschäftsfelder des Vaters
weitergeführt werden konnten. Doch dann geriet Josef in wirtschaftliche
Schwierigkeiten. Viel zu oft blieben die Bauern das Geld für das Vieh,
das er ihnen verkauft hatte, schuldig, und schon bald war eine derart hohe
Summe an Ausständen angewachsen, dass ihm das Geld knapp wurde. Zusätzlich
zeigte sich seine mangelnde Erfahrung bei der Bewertung der Tiere, die
er ankaufte. Er erkannte häufig nicht, wenn ein Tier krank war, oder
er erzielte nicht den erhofften Preis bei der Wiederveräußerung,
weil er minderwertige Tiere zu hoch taxiert hatte.
Bald schon drückten ihn Schulden bei den Banken, die er mit kleineren
Betrügereien zu begleichen versuchte. Dann fälschte er den ersten
Wechsel. Über die Simplizität des Vorgangs war er zu gleichen
Anteilen überrascht und erfreut, wiederholte den Betrug, einmal, zweimal,
hatte bald den Überblick verloren und erkannte spät, dass man
ihm auf die Schliche gekommen war. Im letzten Moment war er über die
nahe Grenze nach Belgien geflohen. Doch wie sollte es weitergehen? Einige
Tage hatte er sich mit finsteren Plänen für eine Zukunft in der
Illegalität gequält. Dann hatte er einen Entschluss gefasst,
war nach Aachen gefahren, um sich dort der Polizei zu stellen, die ihn
verhaftete und dem Untersuchungsrichter vorführte. Im folgenden Prozess
hatte das Urteil ein Jahr Gefängnis wegen fortgesetzten Betrugs in
Tateinheit mit schwerer Urkundenfälschung gelautet.
»Wo sind wir?« Der alte Mann gegenüber war aufgeschreckt
und starrte aus dem Fenster. Entspannt lehnte er sich wieder zurück,
als er erkannt hatte, dass der Zug gerade den Stadtrand von Düren
erreicht hatte. Offensichtlich war sein Reiseziel noch nicht erreicht.
Josef stand auf, nahm den Koffer aus dem Gepäcknetz, zog sein Jackett
zurecht und setzte sich wieder hin. Der gedankliche Rückblick hatte
ihn innerlich aufgewühlt. Plötzlich lastete die Frage nach seiner
Zukunft schwer und drängend auf ihm. In diesem Moment wurde ihm klar,
dass die Weichen neu gestellt werden mussten. Er musste einen Plan entwerfen,
und das so schnell wie möglich.
Der Bahnhof in Düren lag nördlich der Innenstadt an der vielbefahren
Gleisverbindung zwischen Aachen und Köln. Es war ein trutziges Gebäude
im typischen Baustil der Gründerjahre des vergangen Jahrhunderts mit
einer an die historischen Vorbilder der Renaissance erinnernden prachtvollen,
nach Westen ausgerichteten Giebelseite, an der sich der Haupteingang befand.
Auf halber Höhe umspannte ein weit ausladendes, von massiven gusseisernen
Säulen gestütztes Vordach das gesamte Gebäude. In der Bahnhofshalle
waren auch zu dieser Stunde scharenweise Menschen unterwegs. Der Zug hielt
an dem überdachten Bahnsteig, und bald darauf verließen die
Neuankömmlinge die Waggons, vermischten sich mit den Wartenden, strömten
durch die große Halle dem Ausgang zu und waren schon bald nicht mehr
auszumachen in dem Getümmel der vielen Reisenden. (...)
Herbert Pelzer: Durch
die Jahre
407 Seiten, Hardcover, Preis: 24,80 €, Juli 2017,
ISBN 978-3-929386-72-1
Das Buch portofrei bestellen
Mann mit Hut
Eine herrliche Woche
Die Woche ist es leid. Sie hat so viele schöne Tage, aber alles
dreht sich nur um den Sonntag. Das will ihr nicht einleuchten. Und dann
hacken alle auf dem Montag herum. Warum eigentlich? Der ist doch ganz in
Ordnung. Viele feiern ihn sogar, allerdings krank – und ziehen sich die
Decke über den Kopf.
Ein Rätsel ist ihr auch der Samstag. Da haben viele Menschen frei
– aber jede Menge zu tun: Einkaufen, das Auto in die Waschanlage fahren,
ins Theater gehen, die Steuer erklären. Und das Ganze für den
Sonntag – damit Zeit genug bleibt für das andere Müssen: in die
Kirche gehen, mal ein Buch lesen, spazieren gehen. Und: sich erholen.
Das hat sich die Woche nun lange genug mitangesehen. Und sie ist es,
wie gesagt, leid. Morgen, so nimmt sie sich vor, wird alles anders werden.
Da wird sie den Montag auf den Freitag, den Mittwoch auf den Samstag und
den Tatort auf den Dienstag verlegen.
Sie lacht, als sie sich die Menschen und all ihre Versuche vorstellt,
Sinn und Struktur in den neuen Ablauf zu bringen. Irgendwann wird es ihnen
gelingen. Das ist klar. Aber dann würde die Woche ihre Tage erneut
durcheinanderwürfeln, wieder und wieder – so lange, bis die Menschen
aufgeben. Vielleicht, so hofft die Woche, entdecken sie dann die Freiheit
und Schönheit, die jedem ihrer Tage innewohnen. Es wäre immerhin
möglich.
Anja Martin:
Mann
mit Hut - Skurrile Geschichten
Illustrationen: Barbara
Freundlieb, 77 Seiten, Preis: 13,80 €, Juni 2017, ISBN 978-3-929386-74-5
Das Buch portofrei bestellen
Tanz der Kirschblüten
Monika Niehaus:
Die schöne Else
Der gut gekleidete junge Mann, Student der Jurisprudenz und den Freuden
des Studentenlebens nicht abgeneigt, drückt dem Küster ein paar
Groschen in die Hand. Der reicht ihm den Turmschlüssel und verschwindet
rasch wieder in der Sakristei. Nach einem kurzen Blick rundum winkt der
Student seiner Begleiterin, die in einer Nische hinter dem Beichtstuhl
gewartet hat, und steigt mit ihr die schmale Treppe zur Läutekammer
hinauf. Die beiden schlüpfen durch die Tür und treten an die
Fensterluke. Der Blick über die Stadt an diesem klaren, recht milden
Januarabend ist atemberaubend. Vor ihnen liegt das kurfürstliche Schloss,
dahinter der Hofgarten, und in der Ferne glitzern die Fluten des träge
dahin strömenden Rheins. Das Mädchen strahlt, und die Abendsonne
wirft einen bleichen Schein auf sein Gesicht. Lippen, so rot wie Blut,
eine Haut so weiß wie Schnee, Haare so schwarz wie Ebenholz, denkt
der Student. »Wie schön du bist, meine Freundin!«, flüstert
er und zieht sie zu sich heran. Sie lächelt. Die beiden haben keine
Eile. Bis zum nächsten Morgen wird sie niemand stören. Und so
vergessen sie Raum und Zeit, wie es Liebende tun, bis der Student plötzlich
aufhorcht. Vom Kirchplatz dringen aufgeregte Stimmen empor. Er bedeutete
seiner Geliebten zu warten. Er werde nachschauen, flüstert er, was
es mit dem Tumult auf sich habe, und sei gleich wieder da …
********
»Bevor ich vor meinen Schöpfer trete, will ich meine irdischen
Angelegenheiten ordnen. Ich habe stets versucht, meine Pflichten der Kirche
gegenüber getreulich zu erfüllen, doch der Tod eines jungen Mädchens
lastet schwer auf meiner Seele … «
Ich sah von dem Brief auf, den der Pfarrer mir zugeschoben hatte.
»Eines deiner Schäfchen?«
Der Pfarrer bejahte. Er war ein mittelgroßer schlanker Mann mit
fein geschnittenen Gesichtszügen und vollem grauem Haar. Seine Soutane
war wie immer makellos und saß wie angegossen, während sich
mein Knierock ein wenig ausgebeult um meinen Leib spannte. Wir kannten
uns schon seit unserer Studienzeit, also fast einem halben Jahrhundert;
er hatte sich der Seele, ich mich dem Körper zugewandt. Als Arzt stand
ich mit beiden Beinen auf der Erde, einer nicht selten ziemlich schmutzigen
Erde, und hegte eine gewisse Skepsis gegenüber dem Transzendenten,
was unserer Freundschaft aber keinen Abbruch tat.
»Der Küster unseres Münsters. Er liegt im Sterben und
hat schon die letzte Ölung empfangen. Aber jetzt verlangt er nochmals
nach mir. Ich würde mich freuen, wenn du mich begleitest. Als Arzt.
Und als Zeuge.«
»Wenn du meinst, ich kann dir von Nutzen sein, gern«, willigte
ich ein. »Weißt du, worum es geht?«
Der Pfarrer nickte. »Ich denke schon. Es ist lange her, mehr als
30 Jahre, aber der Fall erregte seinerzeit einiges Aufsehen, und der Küster
wurde damals als Zeuge vernommen.«
Ich runzelte die Stirn. »Mir dämmert etwas … diese junge
Frau … hatte sie nicht einen Blumenstand direkt vor dem Münster?«
»Genau, und dort wurde sie am 15. Januar anno 1777 zum letzten
Mal gesehen«, griff mein Freund den Faden auf. »Ich habe mein
Gedächtnis aufgefrischt: Am Abend muss sie das Münster betreten
haben, denn nach Aussagen des Küsters lagen wie immer frische Altarblumen
vor der Sakristei. Danach blieb Else Pütz trotz intensiver Suche wie
vom Erdboden verschwunden.«
»Und da sie nur ein Blumenmädchen war und zudem ohne Verwandtschaft,
erlosch das Interesse an ihrem Verschwinden rasch«, fiel ich ein.
»Die ›schöne Else‹ sei kein Kind von Traurigkeit gewesen, tuschelten
die Marktweiber, und wer weiß, vielleicht hatte sie mit einem fahrenden
Händler oder einem Schiffer auf dem Rhein angebändelt und war
mit ihm auf und davon? Wenn ich mich recht erinnere, wurde die Suche nach
der Verschwundenen bald eingestellt.«
Der Pfarrer nickte. »Aber dir ist vielleicht aufgefallen…«
»… dass in dem Brief nicht vom ›Verschwinden‹ sondern vom ›Tod‹
eines jungen Mädchens die Rede ist«, vollendete ich seinen Satz.
»Das könnte interessant werden.« Ich nahm den letzten
Schluck des durchaus anständigen Burgunders und erhob mich mit einiger
Mühe aus dem tiefen Sessel. »Wir sollten den Mann nicht warten
lassen!« (...)
Bartholomäus Figatowski
(Hrsg.): Tanz der Kirschblüten - Phantastische
Geschichten aus Bonn
Titelbild: Martin Welzel, 165 Seiten, Preis: 12,80 €,
ISBN 978-3-929386-73-8
Das Buch portofrei bestellen
Die geheimnisvolle Welt der Tagebücher
unberühmter Menschen
Schreibend über die Dinge
kommen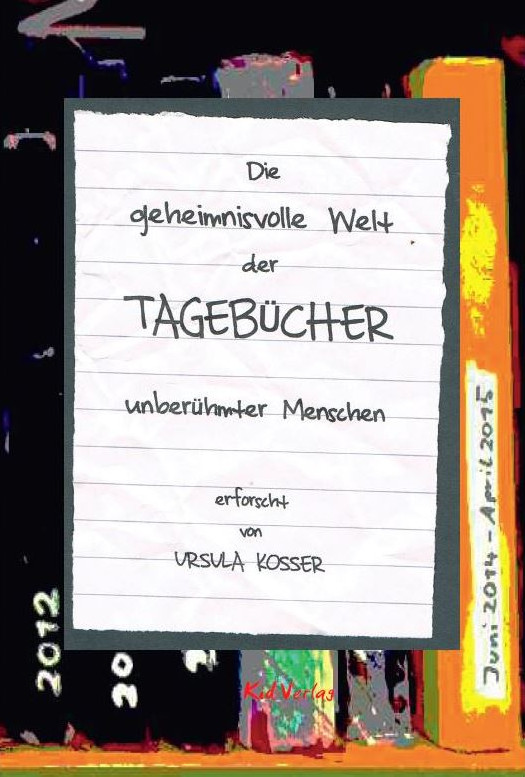
An dieser Stelle wird es höchste Zeit, Britta vorzustellen. Britta
hat mit Tagebüchern so ziemlich alles schon angestellt, was man sich
nur träumen kann. Die knapp 60-Jährige schreibt seit ihrem 13.
Lebensjahr. Sie hat ihre Tagebücher versteckt, ihren Liebhabern daraus
vorgelesen, sie für ihre Kinder geschrieben und das dann doch wieder
verworfen. Sie zerrissen, zusammengeklebt, weggeschmissen und gehütet.
Britta: »Ich kenne auf die Frage ›Leben um zu schreiben oder schreiben
um zu leben?‹ nur diese Antwort ›Ich würde ohne schreiben nicht leben.‹«
Aber von vorne. Manchmal gehen wir einen Kaffee trinken oder zusammen
in die Kirche oder beides. Irgendwann stellte ich ihr die sich tapfer wiederholende
Frage, die ich mit zunehmender Hemmungslosigkeit mittlerweile fast jedem
stelle. Und zwar so häufig, dass es meinen durchaus geduldigen Ehemann
langsam richtig nervt. Drohte er mir jüngst doch tatsächlich
mit zeitweiser Trennung, sollte ich es wagen, den hochrangigen Gastgeber
eines Geschäftsessens beiseite zu nehmen: Ob er eventuell Tagebuch
schreiben würde, beziehungsweise was er davon hielte? Ich fand seine
Besorgnis leicht übertrieben und hielt ihm entgegen, ich hätte
bisher schließlich noch nicht einmal meinen eigenen Verleger danach
gefragt.
Britta jedenfalls antwortet erst gar nicht, sondern kramt in ihrer Tasche.
Zum Vorschein kommen Schlüssel, eine kleine Plastiktasche aus der
Drogerie, zwei Zettel, dann hat sie es gefunden. Triumphierend hält
sie ein kleines handliches Buch, rot eingebunden, hoch. »Hier! Ich
schreibe nicht nur im Bett. Ich verlasse das Haus nicht ohne mein Tagebuch.«
Das weibliche Pendant zu Eberhard, dem Nachfahren Wilhelm Buschs.
Zwei Tage später gehen wir gemeinsam in die Kirche. Wir sind ein
wenig zu früh dran. Britta kramt Ohrstöpsel heraus. Ich frage
sie verwundert nach dem Sinn von Ohrstöpseln kurz vor Beginn des Gottesdienstes.
Sie hört mich nicht, holt ihr Tagebuch heraus und fängt an zu
schreiben. Die kurze Erklärung in meine Richtung: »Ich schreibe
meine letzten Eintragungen.« Es sei schließlich kurz vor Weihnachten,
und bis Silvester müsse sie fertig sein. Fertig?
Deutlich genervt von meiner offensichtlichen Unkenntnis zieht sie die
Stöpsel raus. »Ich muss meine Tagebücher des Jahres – es
sind immer so drei oder vier – bis Silvester gelesen und daraus eine ordentliche
Mind-Map erstellt haben, sonst gibt’s keinen Champagner. Letztes Jahr war
ich in New York. Da ist das beinahe schief gegangen.« »Mind-Map?«,
frage ich hastig, weil der Pfarrer schon seine Kanzel ansteuert. »Das
ist jedes Jahr etwas anderes. Mal mache ich eine große Zeichnung,
in der ich die Ereignisse des Jahres verarbeite. Mal fasse ich sie unter
großen Überschriften noch einmal zusammen.«
Am Nachmittag, beim Tee in ihrer Wohnung, führt sie mir vor, was
das denn auf sich hat mit ihren Mind-Maps. Sie zeigt mir die vom vorigen
Jahr. Auf zwei zusammen geklebten DIN A4 Blättern sehe ich einen großen,
schiefen, blattfüllenden Kreis. Darin sind mehrere kleine Kreise eingeschlossen,
die wiederum mit für mich unleserlich beschrifteten Pfeilen untereinander
verbunden sind. Auch die kleinen Kreise sind schief und haben Lücken,
die Pfeile laufen chaotisch hin und her. Für mich übersetzt Britta
ihre konzentrierte Jahresübersicht: »2014 war nicht so toll.«
Manchmal, erklärt sie weiter, stelle sie das abgelaufene Jahr auch
als Lebenskurve dar. »Die soll aber keiner verstehen außer
mir.« Als ob ich von ihren Kreisen irgendetwas verstanden hätte.
Britta dagegen sieht sich da durchaus in prominenter Gesellschaft. »Ich
mache es ein wenig wie Goethe. Der schrieb sein Tagebuch sogar komplett
in Geheimschrift«, doziert die Gymnasiallehrerin. Das hatte sogar
ich aus meinem Deutschunterricht behalten. Ich habe es dann doch vorsichtshalber
noch einmal nachgeschlagen. Für wichtige Menschen in seiner Umgebung
setzte er in seinen Tagebüchern astronomische Zeichen ein. So verpasste
er seinem Brötchengeber Herzog Carl August den Jupiter, seiner langjährigen
Charlotte von Stein war natürlich die Sonne vorbehalten. Die Goethe-Forschung
ist sich bis heute nicht einig, was der deutscheste aller deutschen Dichter
uns damit sagen wollte.
Warum tut man so was ?
Britta versteht nicht, warum ich das alles frage. Jeder, der etwas Fantasie
hätte, müsse doch irgendwo hin damit. »Schau dir doch den
Goethe an. Der schrieb ständig und öffentlich. Und dennoch hatte
er on top ein Tagebuch. Offenbar weil er es brauchte.« Ihr Leben
fast täglich zu summieren, das ist für sie so selbstverständlich
wie atmen. Sie kann sich nicht vorstellen, dass und wie andere Menschen
ohne ein Tagebuch durchs Leben kommen. Wenn sie ihr Büchlein einmal
vergessen hat, dann schreibt sie auch auf Servietten, Fahrscheine oder
Bierdeckel. »Aber was fällt dir denn nur immer ein?«,
will ich wissen. Britta greift zum Büchlein und liest gestern vor:
Britta
10. Januar 2016 morgens
»Scheißlaune, zu früh wach, alle rüsten auf.
Selbst Banalitäten werden bedrohlich. Ich habe Panik im nächsten
Schuljahr noch mehr Arbeit - mir ist es zu viel.«
So käme sie schreibend über die Dinge, die sie bedrücken
würden. Erst wenn der Druck raus sei, könne sie ihren Tag beginnen.
»Und am Ende des Tages?« »Ich schreibe natürlich
auch noch vorm Einschlafen. Mal kurz, mal lang.« Also gestern:
Britta
10. Januar 2016 abends
Der Pfarrer heute – in der Predigt – recht gehabt. Er erzählte
von dieser Edeka Reklame, in der der Vater alleine Weihnachten feiert und
irre einsam ist. Zum nächsten Jahr schickte er seinen Kindern zu Weihnachten
seine Todesanzeige. Erschüttert kommen sie alle und finden statt eines
Sarges einen gedeckten Weihnachtstisch, an dem der Vater sie einlädt.
Es wird ein rauschendes Fest. Ich muss mehr auf die Menschen zugehen, um
meine Angst zu überwinden, zurückgewiesen zu werden.
Ich bekomme ständig diese Schweißausbrüche. Ist das
meine Angst oder Wechseljahre? Vermutlich eine Mischung von beidem. Ich
will mich nicht kleinkriegen lassen davon. Und merke immer wieder wie die
Angst sich wie ein Spinnennetz in meinen Kopf setzt. Erst krabbelt die
Spinne rum in meinen Gedanken – dann lullt sie diese ein. Ich merke, dass
sie sich nicht mehr bewegen können. Fest eingebunden in widerliche
Fäden, die auch noch den Dreck drum rum an sich ziehen. Und dann nehmen
Schweiß und Angst mir den Atem. Ich will das nicht zulassen.
Dieses Jahr werde ich mutiger.
Ich bleibe ganz ruhig sitzen. Schließlich erzählt mir Britta
gerade Dinge, die sie mir ohne Tagebuch nie erzählen würde. Der
Gatekeeper – wie es so schön bei Journalisten heißt – ist ihr
Tagebuch. Ich sage auch nichts. Britta erwartet keine Antwort. Ich bin
plötzlich sehr dankbar. Ich erlebe intensiv, was der Tagebuchliteraturkenner
Wieland mir eingangs erklärte: »Durch Tagebücher erfährt
man erleichtert, dass es anderen kaum anders ergeht.« Meine spontane
Erkenntnis: Ach, so geht das also mit den Wechseljahren.
»Oh, da habe ich auch eine tolle Geschichte«, erinnert sich
Louise, als wir über Frauen-Fruchtbarkeit und Wechseljahre reden.
Natürlich hat sie dazu eine tolle Geschichte, denn Louise hat sich
schließlich in ihren Tagebüchern mit fast allem beschäftigt,
was Mädchen und Frauen etwas angeht. Zielsicher schlägt sie in
dem Buch mit dem roten chinesischen Einband nach. Da ist die Liebesaffäre
mit Reinhard. Gerade 16 ist Louise, als sie das erste Mal mit ihm schläft,
und prompt bleibt ihre Periode aus. »Du kannst dir nicht vorstellen,
was das für mich bedeutete. Ich war so gut wie nicht aufgeklärt.
Und wovon man so genau die Babys bekam, das war mir auch nicht ganz klar.«
Louise
Ende August 1981
Mein Bruder sagt, dass vor dem Orgasmus schon Samen kommen kann
- kleine Samenergüsse vor dem großen Ausbruch.
Ich bin fertig. Ich drehe dann durch. Irgendwie glaube ich, dass
ich ein Kind bekomme und irgendwie nicht. Ich kann mir das einfach nicht
vorstellen. Ein Kind-ICH-NEIN. Ich bilde mir das vielleicht auch ein. Doch
wenn ich tatsächlich schwanger bin, kann ich einpacken. Ich habe meinen
Eltern einen Brief geschrieben. Sage alles, dann hau ich ab mit Gaby. Nach
Holland. Abtreiben. Zu Hause kann ich nicht bleiben. Ich könnte dann
nach Amsterdam.
Louises Problem löst sich auch im folgenden Urlaub mit den Eltern
nicht auf.
Eine Woche später
An Reinhard denke ich hier kaum. Vorhin dachte ich, Mensch ich will
nicht mehr mit Reinhard gehen. Der ist doch so alt. Aber das ändert
sich garantiert, wenn ich ihn wiedersehe. Meine Scheiß Periode habe
ich immer noch nicht. Hoffentlich bin ich nicht schwanger. Ich habe sie
jetzt schon fünf Wochen fünf Tage nicht. Was soll ich nur tun?
(...)
Ursula Kosser: Die geheimnisvolle
Welt der Tagebücher unberühmter Menschen
140 Seiten, Preis: 12,80 €, ISBN: 978-3-929386-67-7
Inhaltsverzeichnis -
Das
Buch portofrei bestellen
Die besten Kugel-Schreiber 2017
Stefan Pölt: Doppelmord
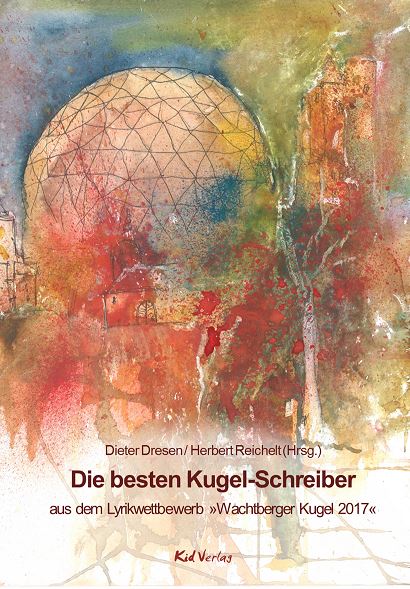
»Mensch, Ruth, ich hab hier grad gelesen,
Frau Schmidt von nebenan …« – »Der Besen?«
»Genau, die lag seit Wochen tot in …«
»Wen wundert das, bei der Despotin!?«
»Na, jedenfalls in ihrer Wohnung
lag …« – »Jochen, gibt es ’ne Belohnung?«
»Ich glaube nicht …« – »Wär doch berechtigt!«
»Kann sein, auf jeden Fall verdächtigt
man ihren Mann …« – »Den armen Softie!«
»… er hätte sie …« – »Weißt du, wie
oft die
ihn schon gereizt hat?« – »Ja, natürlich.
Jetzt hat er …« – »Komm, erzähl ausführlich!«
»… sie wohl erwürgt mit seinen Händen
und dann …« – »Die musste ja so enden!«
»… zerstückelt und verpackt in Kisten …«
»Ich kannte auch mal …« – »Ruth!!« –
»Was
ist denn?«
»Jetzt rede ich!« – »Schon gut, ich schweige …«
»Inzwischen gab’s ’ne Selbstanzeige.
Herrn Schmidts Motiv …« – »Was war es, Jochen?«
»Sie hat ihn ständig unterbrochen!«
Dieter Dresen / Herbert Reichelt
(Hrsg.): Die besten Kugel-Schreiber - aus
dem Lyrikwettbewerb »Wachtberger Kugel 2017«
Hardcover, Preis: 12.- €, ISBN 978-3-929386-68-4
Inhaltsverzeichnis -
Das
Buch portofrei bestellen
Wir machen das! - Leben mit Flüchtlingen
Vorwort
Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit tausende von Menschen Zuflucht
in Deutschland gesucht haben. In den vergangenen Monaten hat die Debatte
über den Umgang mit diesen Flüchtlingen in weiten Bereichen die
Politik bestimmt. AfD und CSU versuchen, mit ausgrenzenden Parolen Stimmen
zu gewinnen. Europa gleicht mittlerweile an vielen Stellen einer Festung.
Das dubiose Abkommen mit der Türkei tut sein Übriges, Flüchtlinge
von Europa fernzuhalten. Derweil suchen die sich andere Wege, und oft ist
die gefährliche Mittelmeerroute die einzige Möglichkeit. Viele
verlieren dabei ihr Leben. Doch das ist nicht mehr im Fokus der Medien.
Nur noch wenige Organisationen kümmern sich um die Not der Menschen
auf dem Meer.
Aber es gibt sie: die große Bereitschaft, den Geflüchteten
zu helfen und sie zu unterstützen. Die rechten Ideologen haben es
nicht geschafft, das gastfreundliche Deutschland mundtot zu machen. Aus
Angela Merkels Aussage „Wir schaffen das!“ ist längst eine Bewegung
geworden, die das tägliche Leben mit den Flüchtlingen mit der
Überzeugung lebt „Wir machen das!“.
In diesem Buch haben wir Menschen, die Flüchtlinge unterstützen,
zu Wort kommen lassen. Die Art der Unterstützung ist unterschiedlich,
und die im Buch gezeigten Beispiele sind ein kleiner Ausschnitt aus den
vielfältigen Aktivitäten von Menschen, die sich für Geflüchtete
einsetzen. Von der Betreuung und Begleitung der Flüchtlinge in Unterkünften,
bis hin zu einem gemeinsamen Leben mit einem jungen Flüchtling. Die
Organisation einer Sommerschule für ganz junge Flüchtlinge oder
Kunstprojekte, die im gemeinsamen Gestalten auch einen Versuch darstellen,
traumatische Erlebnisse zu verarbeiten.
Alle AutorInnen haben auf ein Honorar verzichtet. Stattdessen möchten
sie mit einem Euro pro Buch den »Verein Ausbildung« statt Abschiebung
in Bonn unterstützen. Dieser Verein setzt sich seit Jahren für
die Unterstützung und Stützung vor allem junger unbegleiteter
Flüchtlinge ein.
Alle, die hier zu Wort kommen, haben durch ihre Arbeit, durch ihr Engagement,
viel gelernt und sind nicht mehr dieselben Menschen wie vor einem Jahr.
Trotz aller Schwierigkeiten, trotz kultureller Unterschiede: niemand möchte
die Erfahrung missen. Es ist allen AutorInnen ein Anliegen, weitere Menschen
zu motivieren, sich für Neuankömmlinge einzusetzen. Sie brauchen
unsere Unterstützung, und wir sind in diesem Land reich genug, um
sie ihnen geben zu können.
Amin, minderjährig, unbegleiteter Flüchtling
Den Beitrag von Doro Paß-Weingartz "Amin" finden Sie mittlerweile
im Netz auf der Seite des Beueler
Extra-Dienstes und unter dem Titel "Amin, minderjährig, unbegleiteter
Flüchtling" auf einer Seite des Portals
feinschwarz.net
Ellen Klandt / Doro Paß-Weingartz
(Hrsg.): Wir machen das! - Leben mit
Flüchtlingen
ISBN: 978-3-929386-69-1, 112 Seiten, 11,80 €
Inhaltsverzeichnis
- Das Buch portofrei
bestellen
Lektüre
in der Straßenbahn
Weiß und Schwarz

Die schwere Schwärze dräut von hohem Grund;
lange schon nicht mehr ersehnt, doch von den
Alten immerhin noch karg erinnert;
die Bilder auf den Zungen taugen kaum;
für Junge sind sie nicht mal schönes Wort,
wenn der Begriff sich ihnen nicht erklärt;
was ist Farbe; also kümmern Flammen
blau, bevor sie sterben; Röte wabert
in erkaltend matter Glut, doch wie ist
darin violettes Licht verborgen;
das Knistern, wenn der Zweige Dürre sich
entfacht, wird übertönt vom harten Schlag,
wenn endlich Feuer aus der Rinde gellt,
und zischt zuweilen ein noch feuchter Ast,
er schwängert kalte Luft mit klammem Duft;
selbst welkes Weiß, so alt wie dünnes Licht,
verdient so eben dieses Wort, wenn es
durch hohe Wolken bricht, malt Gräser grün
behaucht das Blatt, in dessen Adern noch
ein letzter Tropfen an der Spitze harrt;
das geschloss’ne Lid durchdringen sanft die
rosa feinen Strahlen, sickert Wärme
durch die Haut, als tanzten hektisch Punkt für
Pünktchen Eintagsfliegen umeinander;
das Jahr kommt in die Flegeljahre, stößt
sich an sich selbst und schafft, als wäre es
das letzte Mal, solang es Zeit noch gibt;
raubt der Nacht jetzt Tag für Tag Minuten,
grad als hätte sie sich schon ergeben;
doch alles wird es wieder von sich werfen.
Rainer Maria Gassen: Lektüre in der
Straßenbahn
mit 25 Frottagen von Haden Young, 104 Seiten, Preis: 13,80 €,
ISBN 978-3-929386-66-0
Das Buch portofrei bestellen
reframing
objects
Bildbespiele aus dem Bildband von Robert Goepel gibt es hier...
Robert Goepel: reframing objects
75 Seiten, Preis: 16,80 €, ISBN: 978-3-929386-64-6
Das Buch portofrei bestellen
Neue deutscheLiteraturgeschichte
Walser gegen Reich-Ranicki –
Tod eines Kritikers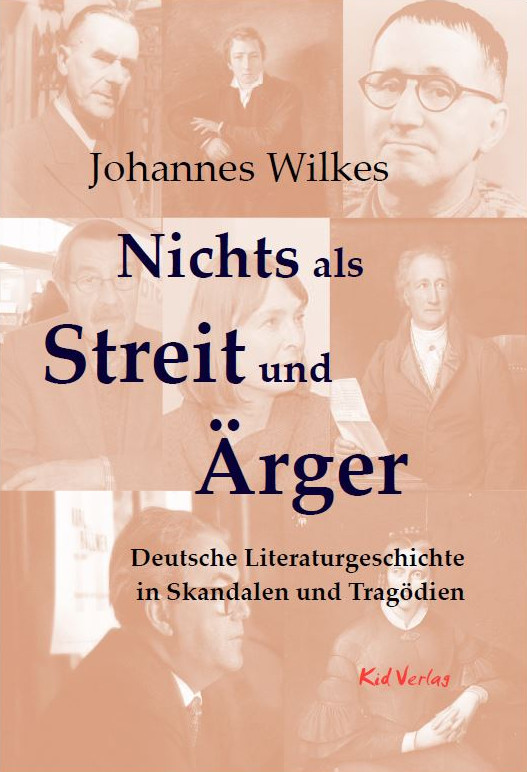
April 2002, ein Baumarkt in der Nähe von Frankfurt. Ein Kunde schreitet
suchend die Regalwände ab, als sein Handy klingelt. Eine SMS. Von
Martin Walser! Wie elektrisiert eilt der Kunde zum Büro des Baumarkts
und äußert eine ungewöhnliche Bitte. Die Baumarktangestellten
sind überrascht, aber der Kunde macht die Sache dringlich, also lässt
man ihn an den Computer. Ein paar Tastendrucke später, dann springt
der Drucker an, wirft die erste Seite des neuen Buchmanuskriptes aus: »Tod
eines Kritikers«
Ein Anruf. Bei Martin Walser. Es ist Siegfried Unseld, sein Freund und
Verleger: »Ein Meisterstück!«
Nicht nur als Buch. Auch als Vorabdruck will es Walser bringen. Mitten
hinein in das Blatt des Mannes, dem der Anschlag gilt. Mitten hinein in
sein publizistisches Herz. In die FAZ. Was für eine Genugtuung wird
das sein! Was für ein Gegenschlag! Klar, in der Redaktion werden sie
daran zu knabbern haben. Aber hatten sie nicht auch seine letzten sechs
Romane als Vorabdruck gebracht?
Der Hass. Gewaltig war er gewachsen in all den Jahren, wie ein Krebsgeschwür,
heimtückisch und unaufhaltsam. Wie hatte er gehofft, wie hatte er
sich danach gesehnt, auch von ihm, von Reich-Ranicki die verdiente, die
endgültige Anerkennung zu bekommen. Und stattdessen? Nur Verrisse!
Natürlich hätte es ihm egal sein können, egal sein müssen,
bekam er doch Lob und Anerkennung von so vielen anderen Seiten. Was störte
da die eine Stimme, die nicht mit einfallen wollte in den kollektiven Lobgesang?
Und doch, der Chor blieb schwachbrüstig ohne ihn, ohne die Leitfigur
des Kritikerchors, ohne Reich-Ranicki. Wie oft, bei wie vielen Neuerscheinungen,
hatte Walser das Fehlen dieser Stimme herausgehört, schmerzhaft herausgehört.
Es hätte ihm egal sein müssen, aber es war ihm nicht egal.
Vielleicht hätte er anders empfunden, wenn die Fronten klarer gewesen
wären. Von Anfang an. Wenn Reich-Ranicki ihm nie eine Chance gegeben,
niemals, wenn er alles, wirklich alles von ihm niedergemacht hätte.
Ausnahmslos. Dann hätte er vielleicht mit den Achseln gezuckt, hätte
»Was soll’s?« gesagt, ihn mit der Zeit nicht weiter ernst genommen.
Doch, und das war das perfide, es hatte durchaus eine Periode gegeben,
als Reich-Ranicki ihm wohl gesonnen schien, als er ihm kleine, süße
Geschenke gemacht, ihn zu den Hoffnungsträgern einer neuen Literatur
gezählt hatte. Wie hatte Reich-Ranicki einst über einen seiner
frühen Romane geschrieben? »Vielleicht hat noch nie ein so schlechtes
Buch eine so große Begabung bewiesen!« Eine so große
Begabung! Was für ein Lob! Und zugleich ein so gnadenloser Verriss.
Wie ging es einem da, welche Gefühle loderten da auf? Es war diese
seltsame Mischung zwischen Bosheiten und aufblitzenden Komplimenten und
Verheißungen, die ihm die Seele zerriss. Mit den hingeworfenen Zuckerstückchen
hatte Reich-Ranicki ihn geködert, hatte ihn abhängig gemacht,
süchtig nach neuem und immer neuem Lob, nach Bestätigung, nach
dem Satz: »Jawohl, jetzt ist es gewiss, wir haben uns in diesem jungen
Autor nicht getäuscht. Er ist einer der Großen, der ganz Großen!«
Doch dieser Satz war ausgeblieben, blieb ihm schmerzlich vorenthalten.
Er sei nicht in der Lage, seinen Figuren echtes Leben einzuhauchen, schüttelte
Reich-Ranicki den Kopf, durch Walsers Romane krieche man wie durch eine
Wüste, immer durstiger nach einer der seltenen Oasen. Das traf. Oh,
wie das traf!
Aber es kam noch schlimmer. Im März 1976 erschien sein Roman »Jenseits
der Liebe«. Die fette, alles erschlagende Überschrift über
Reich-Ranickis Verriss in der FAZ lautete: »Jenseits der Literatur«.
Der endgültige Niedergang einer Hoffnung der Nachkriegsliteratur sei
zu beklagen, schrieb Reich-Ranicki. Was von Walser bliebe, seien einzig
Sterilität und Geschwätzigkeit. Die Worte würden nicht mehr
halten, würden überlaufen. Reich-Ranickis Diagnose: Verbalinkontinenz.
Und dann der alles vernichtende Satz: »Wie schlecht muss ein Walser-Manuskript
eigentlich sein, damit der Suhrkamp-Verlag es ablehnt?«
Jenseits der Literatur. Reich-Ranicki hatte ihn aussortiert. Aus dem
Kreis der Autoren, die in Frage kamen. Wie einen faulen Apfel.
Am gleichen Tag noch, unmittelbar nach der Lektüre dieser Kritik,
stürzt Walser in die Verlagsräume von Suhrkamp, wütend,
aufs Äußerste gereizt: »Wenn ich ein Messer hätte,
ich könnte ihn erstechen!« (...)
Johannes Wilkes: Nichts
als Streit und Ärger – Deutsche Literaturgeschichte in Skandalen
und Tragödien
195 Seiten, Preis: 13,90 €, ISBN: 978-3-929386-61-5
Inhaltsverzeichnis -
Das
Buch portofrei bestellen
Pfleimenbäume
Der arme Bücherwurm

Ein Bücherwurm war’s endlich leid:
Kein leck’res Futter weit und breit!
Roches’ Feuchtgebiete war’n zu nass,
zu trocken war ihm Günter Grass.
Die neuen Krimis fand er fad,
zur Lyrik fehlte ihm der Draht.
An Suter war er überfressen,
und Hemingway war aufgegessen.
Vampire konnt’ er nicht mehr sehen
und Reinhard Jirgl nicht verstehen.
Was anderes war nicht im Haus.
Er wusste nicht mehr ein und aus.
Ganz ausgehungert war er schon,
verfiel in tiefe Depression.
Ach, wär er doch im Bücherladen,
dort könnte er in Büchern baden
und fände sicher neue Nahrung.
Es wäre eine Offenbarung!
Doch dieses öde Buchregal
war ihm ein echtes Jammertal.
Dann aber kam ihm die Idee:
»Wenn ich zum E-Book-Reader geh,
dann habe ich die freie Wahl,
zu Ende wär die Hungersqual!«
Er war nun voller Euphorie.
Die Auswahl war so groß wie nie.
Er fraß und fraß dort ohne Ende
Harry Potter – alle Bände,
verschlang die E-Books nun zuhauf,
es schien ihm fast wie Bulimie.
Dann aber fiel ihm endlich auf:
Die haben ja Null Kalorie!
Die Fresserei war ohne Sinn,
der arme Wurm dann auch bald hin.
Was lernen wir von der Geschicht?
Das E-Book-Lesen bringt es nicht!
Herbert Reichelt: Pfleimenbäume
und andere Gedichte
Umschlaggestaltung: Norbert Bogusch,
Hardcover, Preis: 11,80 €, Mai 2016, ISBN: 978-3-929386-62-2
Das Buch portofrei bestellen
HeimSuchung
1. Kapitel 1913: Josef
Da kam er. Wie gestern und vorgestern. Die Karre, die er schob, ratschte
über das Kopfsteinpflaster. Die Griffe waren die einer Schubkarre,
doch das Gefährt hatte vier Räder. Eine Kiste war auf der vorderen
Hälfte angeschraubt. Unten in der Karre lagen in Fächern Werkzeuge,
die gegeneinander stießen und metallische Töne in unterschiedlichen
Tonlagen hervorbrachten. Den Deckel der Kiste nahm er, hatte er seinen
angestrebten Platz erreicht, herunter und legte ihn auf den hinteren Teil
der Karre, über die Werkzeuge. Kam nun die Kundschaft, griff er in
den verbliebenen Spalt zwischen Kiste und Deckel, der nun seine Arbeitsplatte
war, und holte das passende Werkzeug heraus.
Sie hatte den Eindruck, dass seine besondere Vorliebe die Scheren waren.
Er musterte sie, fuhr mit dem Daumen über die Schneidefläche,
hielt sie wie einen Stab nahe an die Augen, um das Verhältnis der
Flächen zueinander zu bestimmen. Sie errötete, als ob er sie
und nicht die Schere mit den braun gebrannten feingliedrigen Händen
berühren würde.
Wie in den vergangenen Tagen kamen aus den Häusern der Straße
hauptsächlich Hausfrauen mit den Dingen in den Händen, die zu
reparieren waren. Messergriffe, die locker waren, Töpfe, an denen
sich die Henkel gelöst hatten, Scheren jeglicher Form, sogar mit Schmuck
kamen einige. Mit geschickten Handgriffen richtete er die Gegenstände,
kam manchmal ins Gespräch, unterbrach seine Arbeit jedoch nicht. Er
nannte immer einen angemessenen Preis, man sah keinen, der protestierte,
aber auch niemanden, der sich wegdrehte und triumphierte. Der Knecht von
Bauer Moll kam mit einer Sichel und fachsimpelte mit ihm, bis sie gemeinsam
eine Lösung für den wackelnden Griff gefunden hatten. Dafür
nahm er kein Geld. Sie hörte ihn sagen, dass er doch von ihm, dem
Knecht, noch etwas gelernt hätte.
Anna konnte von ihrem Küchenfenster beobachten, wie die Warteschlange
kürzer wurde. Er bediente die letzte Kundin, ausgerechnet Bertha,
die heute Morgen beim Bäcker von ihm geschwärmt hatte. Aber nun
musste sie los. Die alte Schere, die sie eigentlich nicht mehr benutzte
und auch nicht brauchte, hielt sie die ganze Zeit umklammert. Das Metall
hatte sich erwärmt. Genau als Bertha sich zehn Schritte entfernt hatte,
trat sie aus der Tür und ging ihre zehn Schritte auf ihn zu.
Er war ein schöner Mann. Klein, jedoch passte die sportlich schlanke
Figur zur Größe. Das pechschwarze Haar war – wie man im Dorf
sagte – »auf Fasson« geschnitten. Die Gesichtszüge waren
fein, die hohen Backenknochen unterstrichen das. Braune, fast schwarze
Augen unter wie gemalt wirkenden Brauen. Die Haut schimmerte bronzen. Doch
das Schönste war der markant geschnittene Mund, der von einem sehr
gepflegten kurzen Oberlippenbart betont wurde. Der Gesichtsausdruck war
ernst, manchmal mürrisch. Überraschend, wenn er lachte: Die schneeweißen
gleichmäßigen Zähne, die überhaupt nicht hierhin passten.
Christel Spindler: HeimSuchung
163 Seiten, Hardcover, Preis: 14,80 €, April 2016, ISBN 978-3-929386-59-2
(vergriffen)
163 Seiten, Softcover, Preis: 10,40 €, Oktober 2017, ISBN 978-3-929386-80-6
Das Buch portofrei bestellen
Träume, fastumsonst
Herausgegeben von von Barbara Ter-Nedden
Michael Wenzel:
Träume, fast umsonst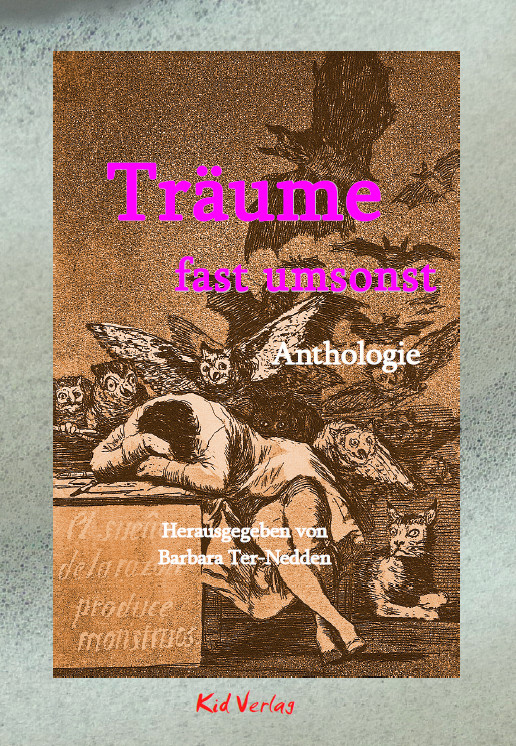
Wohin du flüchtest, hat nichts zu heißen. Nach der letzten
Biegung nimmt jeder sein Ende. Unter der Haut fressen Schmerz und Schmach.
Ein halber Traum ist besser, als für alles zu bezahlen. Wer dort ankommt,
darf unter die Räder kommen, hat nicht den Hauch einer Chance, wird
seinen Lohn schon empfangen, endgültig.
Dorthin wird keine Seele gehen, höchstens du.
Schorsch war gerade sechzehn, als er von Zuhause abhaute. Sechzehn war
er, aufgeschossen, mit großen Händen und langen Armen, wie ein
Gibbon. Bevor er die Türe hinter sich zuknallte, plättete er
dem, der ihn sich mal wieder zurechtbiegen wollte, die Nase, trat ihm in
den Bauch, als er am Boden dahinkroch.
Und dann flammte dieses Bild wieder in seinem Schädel auf: grellrot
und orange. In den Farben des Abgrundes und in denen, die aus der Angst
stammen. Schreie im Kopf, meine Haut ist giftig, am Himmel steht geschrieben,
dass stirbt, wer mich berührt.
Brüllend keilte er auf den unten ein, kickte ihm in die Rippen
und zwischen die Beine, bis die Mutter aufgelöst und wie irre an ihm
hing, ihn wegzerrte. Heißes Salz in den Augen. Er sah ihr wirres
Haar und im Gesicht den rot verschmierten Mund, offen und wie immer hilflos
Bitten stammelnd; und über sie hinweg sah er, wie dieser da, der sein
Vater war, sich in einer Bierlache krümmte. Wurm, von dem ich bin.
Er drehte sich weg. Fleisch verbiegt sich, die Wunden sind nie ausgebrannt.
Wer salbt mich mit Öl? Die Augen blutig vom unsichtbaren Weinen.
Als er später aus seinem Zimmer stürzte, die Sporttasche mit
Klamotten und einigen Habseligkeiten über der Schulter, hörte
er hinter der Tür ihr Flehen und gleich darauf das Klatschen einer
Hand auf nacktem Fleisch.
Vor ihm ein verzerrtes Gesicht im Flurspiegel, ein paar kitschige Plastikrosen
hinter den Rahmen geklemmt, und er schnappte sich das nächstbeste
Ding, donnerte es in das Gesicht, das in tausend Splittern wegbrach. Er
knallte die Wohnungstür zu, stürzte die Treppe hinunter, um nur
endlich, endlich fort zu sein.
Tret’ ins Pflaster,
hau ab und um die Ecke,
gewinne Land,
geh zum Teufel,
weiter als weg.
Alles verlassen,
bis auf sich selbst.
Eine Zeitlang trieb er sich herum, bettelte da und dort was zusammen.
Doch die Wortfetzen, die er brummend von sich gab, machten den Leuten Angst.
Er kannte nicht das Spiel mit den Bitten und dem geheuchelten Blick und
wollte es nicht lernen, begriff die Regeln nicht, die hier herrschten.
Es waren zu viele, die nichts hatten, und zu wenige, die abgeben wollten.
Den Verlassenen und den Verzagten trennen die gleichen Dunkelheiten. Niemand
hatte auf ihn gewartet. Wenn das Betteln die Liebe ersetzt, der abgewiesene
Blick die Tränen, hat verloren, was unterm Strich bleibt.
Der Engel verkündete eine gnadenlose Zeit, die Reise fand nicht
statt. Schorsch kam im Nirgendwo an, es hätte auch woanders sein können.
Ab und an Arbeit: Kisten schleppen, Dreck schippen, Autos waschen.
Er war in einer jener Städte, von denen es zu viele gab, aus misslungenen
Vorlagen kopiert, ohne Vergangenheit, dann und wann verfallen an eine irre
Sehnsucht: gelbe Abgaswolken über ihr, stampfende Industrieanlagen
ringsum und Lagerhallen, Tankstellen und Baumärkte, von Neongeflimmer
und schreienden Reklamen überdeckt – saubillig, willig, jederzeit.
Und bei Tag und Nacht röhrte der Verkehr auf Asphaltschlaufen um Autobahnkreuze
und Zubringer. Planquadrate von Verkehrsadern und Kanalisation durchzogen.
Kahler Beton am Rand, verrottete Fabriken, Sozialgettos, an denen die Nässe
fingerte, der Putz in Fladen abfiel, und Papierfetzen aufgespießt
im Geäst der Bäume, als hätte man Tiere geopfert, einem
fremden Gott.
Es war Hochsommer, und er nächtigte auf einem alten Bahnhofsgelände,
wo endlose Kolonnen von Güterwaggons, massig wie Geschöpfe der
Urzeit, rasselnd über die Gleise rumpelten. Wo, auf dem Boden ausgestreckt,
die warme Erde unter ihm zu zittern schien.
Wir legen uns nieder, halten fein Ruh,
decken den Schmerz mit dem Himmel zu,
Schorf und Grind über der Haut,
das Schweigegeld gibt keiner preis.
Eingehüllt in den Duft alten Maschinenöls und wilder Lupinen
lag er da, unter ungezählten Sternen. Die Blumen folgten ihm in die
Träume, die über dem Abgrund blühten. Frühmorgens stieg
flimmernd die Sonne auf, mächtig und rund, schob den Schummer der
Nacht hinweg. Verbeulte Fässer und Gerümpel im Dämmerschlaf.
Eine Amsel besang das junge Licht. In den abgefahrenen Gleisen, zwischen
denen Unkraut wucherte, blitzten Sonnenflecken. Ein satter Erdgeruch und
irgendwo dahinter der letzte Hoffnungsstaub.
An den langen Herbsttagen, die nicht enden wollen, hockte er auf der
öligen Rampe eines Lagerschuppens und starrte in den Regen hinaus,
der in endlosen Schnüren auf das Gelände fiel. Kohlehalden und
Lastkräne. Schlammpfützen, verrostetes Zeug und glänzender
Schotter. Schwarzes Wasser, aus dem du Vergessen trinkst. Er ging durch
die Straßen, eine Bierdose rollte dahin, Dampf stieg aus den Gullys.
Seine Hände schaufelten Luft. In jedem Fenster ein warmes Licht, die
Häuser schmiegten sich aneinander. Dieser Abend wird ohne Heimat sein.
Die Liebe taugt nicht zum Verzeihen.
Wenn du mich frisst
mit Haut und Haaren,
schiebe ich blutiges Brot
zwischen deine schwarzen Zähne.
Dann arbeitete er auf dem Bau, hauste mit einem Dutzend Männer
aus aller Welt in einem Container. Ihre Sprachen: ein einziges Wirrsal.
Am Rande der Stadt zogen sie Wohnblöcke hoch. Silos für Menschentiere,
Türme aus Armierungen und Eisenbeton. Ameisen zwischen Kränen
und Gerüsten. Baugruben des Glücks, wühlend in der Tiefe,
empor zu den Wolken. Der Name im Fundament vergessen. Die Mauerwächter
sind längst entschlafen.
Von der Arbeit wurden seine Hände hart. Dort lernte er, die aus
dem Osten und die Türken und Asylanten, all das Geschmeiß, seien
daran schuld, dass er keine gescheite Arbeit fände. Der dicke Polier
mit der Bierfahne zeigte ihm die großen schwarzen Überschriften
in der Zeitung, wo stand, wer in Wahrheit das Geld einstrich, aus dem Vollen
schöpfte, wer log und betrog.
Er lachte, als Schorsch in die Zeitung glotzte, die wusste, wie wenig
er zu erhoffen hatte.
Was die andern haben, fehlt uns doppelt.
Was wir ersehnen, gilt ihnen nichts.
Was wir morgens bauen, brechen sie am Abend ab.
Nachher scheuchte ihn der Polier zum Betonieren an die Schütte
hinüber, wo der flüssige Zement herunterschoss und er nass und
wie ein Schwein im Matsch stampfte. Wenn er am Abend zur Baubaracke wankte,
mit weichen Knien und verkrampften Händen, den erstarrten Beton auf
den Klamotten, lachte der Polier wieder: Er rief, dass man so einem, der
aus dem Dreck käme, es auch gleich ansehen müsse. Schorsch stapfte
an ihm vorbei, erwiderte nichts, schob alles in den Bauch hinein.
Halte die Faust in der Tasche.
Du kennst das Gesicht im lachenden Hass.
Er ruft dir zu: sei mein Bruder. (...)
Barbara Ter-Nedden (Hrsg.): Träume,
fast umsonst, 118 Seiten, 12,80 €, Hardcover, ISBN: 978-3-929386-63-9
Das Buch portofrei bestellen
Liebesverspbrechen
Prolog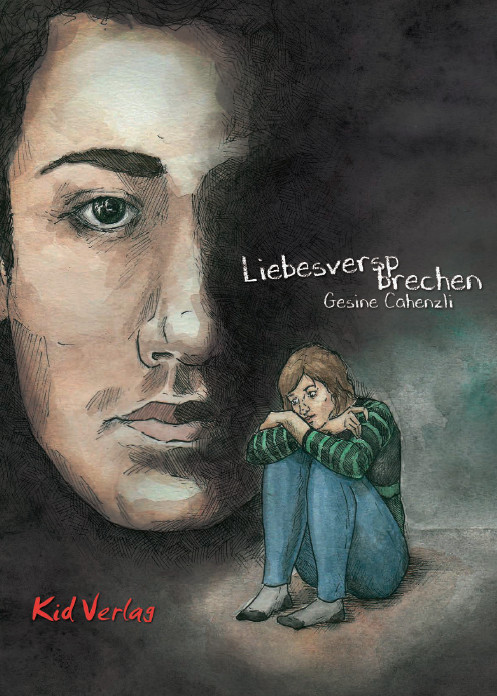
Es gibt Träume, aus denen man nicht mehr erwachen möchte,
und es gibt Albträume, deren Ende man herbeisehnt.
Ich habe einen Albtraum gelebt, dessen Bilder mich bis heute verfolgen.
Vielleicht werde ich sie niemals vergessen können.
Ich habe mich entschlossen, meine Geschichte aufzuschreiben, weil ich
selbst verstehen möchte, warum ich die Trugbilder nicht eher durchschaut
habe, warum ich mich von diesem Traum nicht früher losreißen
konnte.
Es war der Traum von der großen Liebe. Von einem, der kommt und
mich in den Armen hält. Von einem, der mich begehrt, so wie ich bin.
Von einem, der zu mir hält, was auch immer passiert.
Wenn du meine Geschichte liest, dann wirst du vielleicht denken, wie
kann man nur? Wie kann man nur so blind sein?
Und das frage ich mich heute selbst. Wie konnte ich nur so blind sein?
Aber eines weiß ich. Es war der Traum von der großen Liebe,
ein Traum, den wir alle irgendwie träumen, der mich so blind gemacht
hat. Und weil zur großen Liebe das große Vertrauen gehört,
habe ich vertraut und sogar blind vertraut.
Inzwischen habe ich gelernt, dass ich eines niemals aufgeben darf,
nicht einmal für die ganz große Liebe - mich selbst.
Sophie
Gesine Cahenzli: Liebesverspbrechen,
94 Seiten, 10,40 €, ISBN 978-3-929386-60-8
Das Buch portofrei bestellen
Elly Ney und Karlrobert Kreiten
Vorwort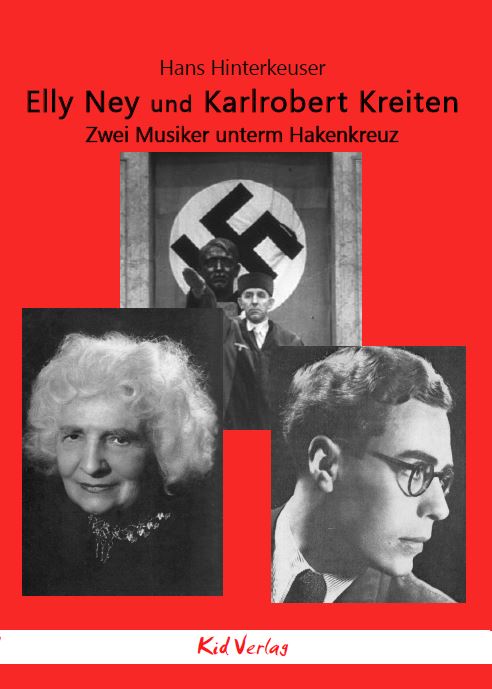
Dieses Hakenkreuz war für die eine das Emblem ihrer Identifikation,
für den anderen bedeutete es das Martyrium.
Der aus Bonn stammende Pianist Karlrobert Kreiten wurde am 26. Juni
1916 vor nun fast einhundert Jahren geboren; zu Tode kam er durch die NS-Justiz,
die ihn durch Roland Freisler im „Volksgerichtshof“ verurteilte und
dem Strang in Berlin-Plötzensee auslieferte. Das war am 7. September
1943, und Karlrobert Kreiten war ganze 27 Jahre alt, die größte
Hoffnung für die Pianistenszene in Deutschland, wie sein Lehrer Claudio
Arrau bekannte.
Im Jahre 2016 ist es Zeit, sich wieder an Karlrobert Kreiten zu erinnern,
der zumindest in Bonn bis ins Jahr 1984 weitgehend vergessen war. In diesem
Jahr wurden Ausstellungen und Konzerte in memoriam organisiert, und schließlich
gab es auch eine Straßenbenennung mit seinem Namen.
Wer war dieser Karlrobert Kreiten? Um das herauszufinden, kann man biographische
Daten zusammenstellen. Dies ergibt ein persönliches Bild des großen
Musikers. Deutlicher wird dieses Bild aber noch, wenn es vor den Hintergrund
der Zeitereignisse seiner Lebenszeit gestellt wird. Das Bild gewinnt an
Schärfe, wenn es kontrastiert wird durch ein Gegenbild, das sich gewissermaßen
aufdrängt: dies ist die Pianistin Elly Ney, ebenfalls Bonnerin. Soviel
beide weit über ihren Beruf hinaus an Gemeinsamkeiten hatten, eines
aber unterscheidet sie diametral: es stehen sich hier glühende Befürworterin
und beklagenswertes Opfer eines Regimes gegenüber, so dass man geradezu
von spiegel-bildlichen Biographien sprechen könnte. Verständlich
werden diese Biographien aber überhaupt nur ansatzweise, wenn wir
sie im Zusammenhang der Zeitläufe sehen, in die beide Personen eingebettet
waren. Das „Dritte Reich“ war kein singuläres geschichtliches
Ereignis, sondern hat eine lange Vorgeschichte, die man bis zur Aufklärung
des 18. Jh. und der Französischen Revolution von 1789 zurückverfolgen
muss. Denn hier, als vor allem von Jean Jacques Rousseau (1712-1778) der
Begriff „Gott“ – vor dem (zumindest theoretisch) als Geschöpfe alle
Menschen gleich waren - durch den Begriff der „Natur“ bzw. der „Vernunft“
ersetzt wurde, Vernunft und Natur damit aber vergöttlicht wurden,
entstand die Spaltung zwischen einer humanistischen Linie, die nach Gemeinsamkeiten
sucht („alle Menschen sind von Natur aus im Grundsatz gleich, z.B. vor
dem Gesetz“) und einer chauvinistischen Linie, die die Unterschiede
betont („die Menschen sind von Natur aus im Grundsatz verschieden, z.B.
genetisch nach Rasse“). In diese letztere Linie z.B. ordnet sich der Philosoph
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) ein. Nach dem Ende des „Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation“ versuchte er sich an der Konstruktion einer neuen
nationalen Identität der Deutschen. In seinen „Reden an die deutsche
Nation“ sprach er von den Deutschen als „Urvolk“. Das Volk ist demnach
Ausdruck „göttlich inspirierter Ordnung“ und steht somit über
dem Staat, für den alle Staatsbürger gleiche Rechte besitzen.
Der bürgerliche Staat ist für ihn nur insoweit Mittel zum Zweck,
wie er dem „höheren“ Zweck und Nutzen des kulturell homogenen Volkes
dient. Diese Mystifizierung des „Volkes“ hält zwar keiner historisch-kritischen
Betrachtung stand, wenn das „Deutsche“ vor allem auf das „Germanische“
reduziert wird, taugte aber als Propaganda für den Kampf gegen den
„Erbfeind“ Frankreich. Das Nationale am Deutschen wird folgerichtig hier
schon in scharfer Abgrenzung gegen alles „Fremde“ gesehen: „…jene weichliche
Führung der Zügel des Staats, die mit ausländischen Worten
sich Humanität, Liberalität und Popularität nennt, die aber
richtiger in deutscher Sprache Schlaffheit und ein Betragen ohne Würde
zu nennen ist.“ Hier ist schon alles vorformuliert, was in der Polemik
der Nationalsozialisten gegen demokratische Prinzipien und solche der Menschenrechte
wieder erscheint. Der nächste Schritt ist dann der vom kulturell einheitlichen
zum rassisch homogenen Volk, in scharfer Abgrenzung gegen andere Völker
wie Kulturen.
Diese Spaltung in den Grundüberzeugungen beförderte und befeuerte
seit den Anfängen des 19. Jahrhunderts, verstärkt durch die Kriege
Napoleons und die Versuche, das „Deutsche“ militant gegen den „Korsen“
zu setzen, diametral unterschiedliche Gesellschafts- und Zukunftsvorstellungen,
deren Auseinandersetzung in dem vom NS-Regime mit Plan begonnenen 2. Weltkrieg
eskalierte, die aber auch im 21. Jahrhundert keineswegs überwunden
ist. Adorno und Horkheimer haben in ihrer „Dialektik der Aufklärung“
im Kriegsjahr 1944 im amerikanischen Exil zuerst darauf hingewiesen, dass
Aufklärung kein unumkehrbarer Prozess ist, dass sie im Gegenteil in
sich die Tendenz zur Selbstzerstörung trägt, dass sie in Mythologie
zurückschlagen kann. „Wir hegen keinen Zweifel …daß die Freiheit
in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist. Jedoch
glauben wir, genauso deutlich erkannt zu haben, daß der Begriff eben
dieses Denkens, nicht weniger als die konkreten historischen Formen, die
Institutionen der Gesellschaft, in die es verflochten ist, schon den Keim
zu jenem Rückschritt enthalten, der heute überall sich ereignet.
Nimmt Aufklärung die Reflexion auf jenes rückläufige Moment
nicht in sich auf, so besiegelt sie ihr eigenes Schicksal.“ Ein entscheidendes
Moment darf dabei nicht übersehen werden: „Was die Menschen von der
Natur lernen wollen, ist sie anzuwenden, um sie und die Menschen vollends
zu beherrschen.“ Auch das Schlimmste, was Menschen angetan werden
kann, kann eine rationale Begründung erhalten. So war denn für
Hitler die Vernichtung der europäischen Juden nichts Willkürliches,
sondern konnte, im Sinne des Erhalts von Rasse und Nation, als naturnotwendig
und vernünftig deklariert werden.
In diesen Zusammenhängen stehen auch die Schicksale unserer beiden
Hauptfiguren. Es kann folglich nicht genügen, sich gegen das „Böse“
zu empören, wenn nicht klar wird, woher es kommt und wie es wirkt.
(...)
Hans Hinterkeuser: Elly
Ney und Karlrobert Kreiten – Zwei Musiker unterm Hakenkreuz
204 Seiten, mit zahlreichen Fotografien und Dokumenten, Preis: 13,80
€, ISBN: 978-3-929386-53-0
Das Buch portofrei bestellen
Diplomat
in Uniform
Deutsch-Deutsche Beziehungen
in Algier – Fluchthilfe durch die Sahara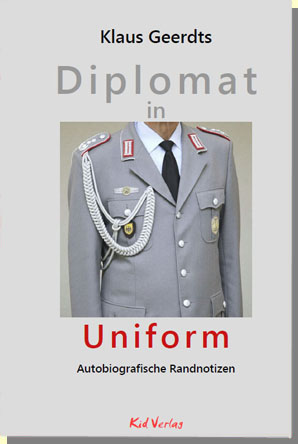
Seit 1848 galt Algerien für die Franzosen als ein Teil Frankreichs.
1962 endete ein acht Jahre währender blutiger, erbarmungsloser Kampf
zwischen der algerischen Unabhängigkeitsbewegung FLN mit ihren bewaffneten
Kräften, der Armée de Liberation Nationale (ALN), und den französischen
Streitkräften sowie Algeriern untereinander. Am 05. Juli 1962 wurde
die Demokratische Volksrepublik Algerien ausgerufen. Die Mehrzahl der französischen
Siedler (Pieds Noirs) floh nach Frankreich. Seit 1965 verfolgte Oberst
Houari Boumedienne als Staatspräsident eine rigorose Sozialisierungspolitik.
Zugleich öffnete er das Land dem Ostblock gegenüber, um die noch
vorhandene wirtschaftliche Abhängigkeit Algeriens von Frankreich abzumildern.
Mit mehreren Ländern des Ostblocks begann er Großprojekte der
Industrie wie Stahl– und Walzwerke oder Raffinerien zu planen und zu verwirklichen.
Dank der Hallstein-Doktrin (die Aufnahme diplomatischer Beziehungen von
Drittstaaten zur DDR galt für die Bundesregierung in Bonn als ein
unfreundlicher Akt) zögerte die algerische Regierung bis zum Dezember
1970, normale diplomatische Beziehungen zu Ostberlin einzurichten. Dann
schloss sie eine Reihe von Abkommen zur Entwicklung des Landes, der Hochschulen
und der Industrie mit der DDR ab; der Staatssicherheitsdienst unterstützte
den Aufbau der Sécurité Militaire durch Personal und Ausrüstung.
Eine große Zahl deutscher Bürger aus der DDR arbeitete über
das Land verstreut in Algerien; sie war zum Teil sogar kaserniert. Dem
Vernehmen nach durften die DDR–Bürger nur an dem muslimischen Wochenende
(Freitag) ihre Unterkünfte gemeinsam verlassen. Ich rieb mir verwundert
die Augen, als bei einem unserer ersten Strandbesuche am Wochenende im
November 1980 drei Busse oberhalb des Strandes parkten, zahlreiche Familien
mit Kindern an das Meer eilten oder sich am Strand mit Picknickkoffern
niederließen – wir hörten aus der Ferne deutsche Sprachfetzen.
Nach genau zwei Stunden trillerten Signalpfeifen, die Besucher stiegen
eiligen Schrittes wieder in die Busse ein. Im Laufe der Zeit versuchten
wir bei den erneuten Begegnungen erste Kontakte zu knüpfen. Die Angesprochenen
wandten sich jedoch stets ab, sie liefen an das Wasser oder packten ihre
Sachen zusammen. Ein Kontakt zu uns „westlichen“ Deutschen schien ihnen
verboten zu sein.
Unsere Botschaft und das Konsulat blieben bis auf einen Bereitschaftsdienst
am Freitag stets geschlossen. Wir konnten nicht ahnen, welche dramatischen
Ereignisse uns an einigen Wochenenden in den Jahren 1981 und 1982 bevorstanden.
An einem Freitag meldete sich ein DDR–Bürger bei dem Bereitschaftsdienst
in der Botschaft mit der Bitte um einen Pass der Bundesrepublik. Er erhielt
ihn auf Weisung des Botschafters am folgenden Tag überreicht. Für
eine Ausreise nach Deutschland benötigte der DDR–Bürger jedoch
einen algerischen „Einreise–Stempel“. Hoffnungsfroh eilte ein Konsularbeamter
mit dem DDR–Bürger zu dem entsprechenden Referat im algerischen Innenministerium.
Das Gespräch endete als ein Fiasko. Der DDR–Bürger wurde für
kurze Zeit verhaftet, letztlich dann aber doch nach Westdeutschland abgeschoben,
während der Konsularbeamter als Persona non grata eingestuft wurde
und umgehend nach Bonn ausreisen musste. Dort wurde der Diplomat dann mit
der von ihm gewünschten Verwendung in einem wichtigen asiatischen
Land „belohnt“.
Kurze Zeit danach erhielt Botschafter Gerd Berendonck den Hinweis aus
dem algerischen Außenministerium, er möge die algerische Regierung
aus diesen „Querelles Allemandes“ (deutschen Streitereien) heraushalten.
Berendonck sah dies als einen Freibrief an, zukünftig eigene Initiativen
zu ergreifen, um notfalls DDR–Bürgern auf dem Weg in die Bundesrepublik
zu helfen. Das Auswärtige Amt gab ihm hierzu grünes Licht und
wies ihm auch ein kleines Budget an, mit der Auflage, dass keinerlei Aktionen
bekannt werden dürften, die die offiziellen Beziehungen zu Algerien
stören könnten. Die einzelnen „ Ausreisen“ durften direkt zwischen
den betroffenen Botschaften in Algier und in Tunis abgesprochen werden.
In unregelmäßigen Abständen meldeten sich innerhalb
weniger Monate, stets am Freitag, wiederholt DDR-Bürger, denen es
gelungen war, aus ihren Lagern oder Baustellen im Landesinneren unsere
Botschaft zu erreichen. Glücklicherweise standen 2 Zimmer in dem Botschaftsgebäude
zur Verfügung, in denen die Flüchtlinge für einige Tage
verweilen konnten. Das Ausstellen der Pässe erfolgte in der Botschaft
zügig, doch dann blieb die Frage ungelöst, wie diese Menschen
aus Algerien gelangen, ohne die neuen Pässe an dem Grenzübergang
vorzuzeigen – eine offizielle Ausreise mit dem Schiff oder dem Flugzeug
schied aus. Es bot sich also nur eine Ausreise auf dem Landweg über
Tunesien oder Marokko an. Die algerisch– marokkanische Grenze überwachten
marokkanische Grenzsoldaten scharf, um einen möglichen Waffenschmuggel
für die Befreiungsbewegung Polisario zu verhindern. Hingegen waren
die algerisch-tunesischen Beziehungen unbelastet. Von unseren kurzen Urlaubsreisen
zu dem Nachbarn im Osten wussten wir, dass die Kontrollen sich auf die
Grenzübergänge beschränkten, und die weitgehend geradlinig
verlaufende Grenze durch die Wüste unbewacht war.
Nur ein kleiner Kreis der Mitarbeiter an der Botschaft wusste um die
„Gäste“ in den Zimmern unter dem Dach. Aus diesem kleinen Kreis bat
der Botschafter Mitarbeiter, zunächst einmal die möglichen Grenzübertritte
zu erkunden. Die Flüchtlinge sollten möglichst nahe an die mehr
als 500 km entfernte Grenze zu Tunesien mit einem Auto gefahren werden,
um dann nachts zu Fuß auf die andere Seite zu wechseln. Dort erwarteten
sie dann Mitarbeiter unserer Botschaft aus Tunis in dem nächstgelegenen
Dorf. Für die Ausreise aus Tunesien genügte der neue Pass ohne
einen tunesischen Einreisestempel.
Die Erkundungen, die der Botschafter, andere Mitarbeiter und wir durchführten,
tarnten wir als Ausflüge mit unseren Familien; wir verfügten
über keine Straßenkarten außer der Michelin–Straßenkarte
Nr.153 (Afrika Nord und West) im Maßstab 1:4 Millionen. Sie nutzte
uns für die Vorhaben wenig. Wir fertigten deshalb Skizzen an, die
den Familien dann helfen sollten, die grobe Richtung gen Osten einzuhalten.
Die Hilfsaktionen trugen eine hohe politische Brisanz in sich. Wir halfen
ja unseren Mitbürgern aus der DDR, Algerien auf einem nicht gesetzlichen
Weg zu verlassen. Um die Brisanz etwas zu verringern, suchte Botschafter
Berendonck Mitarbeiter, die sich freiwillig bereit erklärten, den
Transport der Flüchtlinge bis zu der tunesischen Grenze in ihrem eigenen
Fahrzeug zu übernehmen. Die Kollegen durften nicht auf der Diplomatenliste
des algerischen Außenministeriums stehen. Die Liste enthielt nur
die Namen der Angehörigen des „höheren“ Dienstes an der Botschaft.
Ich war tief beeindruckt, wie die Mitarbeiter immer wieder das Risiko bedingungslos
eingingen.
Die geflüchteten Personen bestiegen in der Garage der Botschaft
das Auto und versteckten sich unter Decken. Schnell fuhr der Mitarbeiter
dann in Richtung Osten, um nach 5 – 6 Stunden Fahrt an dem erkundeten Punkt
grenznah zu halten. Die Flüchtlinge gelangten, bis auf zwei Ausnahmen,
immer glücklich auf die tunesische Seite. Der Weg in die Bundesrepublik
war dann für sie frei.
Einmal verlor eine Familie mit drei Kindern die Richtung und lief in
der Dunkelheit im Kreis. Sie gelangten nach anderthalb Stunden wieder an
den Ausgangspunkt, wo der Fahrer der Botschaft sich noch von der Hinfahrt
schlafend erholte. Ihr zweiter Versuch endete dann glücklich nahe
einem tunesischen Dorf.
Eine der seltenen algerischen Grenzstreifen traf kurz darauf auf eine
andere Familie mit 2 Kindern. Sie nahmen sie zu ihrer Grenzstation mit.
Den Kindern und der Frau boten die Soldaten Tee und Wasser an, während
sie den Mann vernahmen. Nach etlichen Telefonaten hießen sie die
Familie, in den Streifenwagen wieder einzusteigen. Sie fuhren bis zu dem
Punkt, an dem sie die Familie Stunden zuvor festgesetzt hatten. Vor dem
herzlichen Abschied zeigten die Soldaten die ungefähre Richtung, die
die Familie einschlagen sollte, um jetzt über die Grenze zu kommen.
Im Morgengrauen konnten unsere Kollegen aus Tunis die erschöpfte Familie
dann zufrieden empfangen. Dieser Fall zeigte uns den festen Willen der
algerischen Regierung, sich nicht aktiv in diese „innerdeutschen“ Aktivitäten
einzumischen.
Ganz und gar keine Freude bereitete die zunehmende Zahl der Flüchtlinge
natürlich den Offizieren des ostdeutschen Staatssicherheitsdienstes,
die für die Überwachung auf den Baustellen zuständig waren.
Schon bald nach der Ankunft einer Familie in unserer Botschaft stellten
wir in kurzer Entfernung von dem Botschaftsgebäude ein Fahrzeug fest,
das mit seinem Fahrer das ganze Wochenende über dort parkte – eine
Kamera lag aufnahmebereit auf dem Schoß des Fahrers. Ich versuchte,
den Fahrer anzusprechen – vergeblich. Er gab sich schlafend und verschwand
am Samstag.
Am Freitag, den 03. Dezember 1982, meldete sich morgens ein Diplomingenieur
mit seiner dreiköpfigen Familie – er leitete eine Großbaustelle.
Wenige Stunden später parkten 2 Fahrzeuge mit etwa 100 m Abstand vor
der Botschaft. Die Abstimmung mit der Botschaft in Tunis nahm länger
als üblich Zeit in Anspruch. Wir konnten deshalb die nun schon zur
Routine gewordenen Hilfsmaßnahmen erst nach 3 Tagen beginnen. (...)
Klaus Geerdts: Diplomat
in Uniform - Autobiografische Randnotizen
197 Seiten, mit zahlreichen Fotografien des Autors, Hardcover, 13,80
€, ISBN 978-3-929386-57-8
Das Buch portofrei bestellen
noch mehr Leseproben gibt es hier...
Start